nicht die Theoretiker, die das Wissen über den Schatten überzeugend formuliert haben.
Die Schattenforscher der Aufklärung waren zunächst von der Frage geleitet, welche Information der Schatten über die Dinge gibt, die ihn verursachen: Sie untersuchten den Fall von Molyneux' Blinden. Kann ein Blindgeborener, der später das Sehen erlernt, nur durch den Gesichtssinn, ohne nochmalige Berührung der Gegenstände, Kugel und Würfel einem Begriff zuordnen? Ist die Fähigkeit, eine Erscheinung und ihre Ursache zu verknüpfen, angeboren, oder muß sie durch Erfahrung erworben werden? Locke hatte diesen Problemen, die die englische Wissenschaft in Empiristen und Nativisten spalteten, mit dem Beispiel des beschatteten Kreises eine emblematische Figur gegeben. Sie brachte die Frage, wie aus einer zweidimensionalen Anordnung von Reizen auf der Netzhaut das Bild einer dreidimensionalen Welt entsteht, auf den Punkt: Warum und wie deuten wir den beschatteten Kreis als Kugel? Die Wahrnehmung des Schattens richtete sich auf die Erkenntnis der Form, die ihn hervorbringt.
In Frankreich wurde der Schatten selbst Gegenstand der wissenschaftlichen Neugierde. Es waren vor allem die Farben und die Tonwerte im Schatten, die die Aufmerksamkeit erregten, aber auch dessen Ränder und die Intensität der Dunkelheit. Vom Schatten als Zeugen der Gegenstandsform war keine Rede mehr. Mit der notwendigen Freiheit eines selbstbewußten Forschers schlägt Baxandall Schneisen in die Quellen. Er trennt aus der Traktatliteratur die Passagen, die den Schatten betreffen, heraus und stellt sie, ihren ursprünglichen Kontext vernachlässigend, thesenhaft gegeneinander.
Obwohl in den Malereihandbüchern des achtzehnten Jahrhunderts häufig behandelt, gab es selten feste Regeln für die Darstellung des Schattens. Gérard de Lairesse und Jacques Gautier d'Agoty verwiesen den Maler als professionellen Beobachter auf sein Auge und sein Urteilsvermögen. Immer wieder gibt es Rückgriffe auf Leonardo, dessen - von Baxandall im Anhang ausführlich kommentierter - Traktat viele Theorien des achtzehnten Jahrhunderts grundiert. Einige der interessantesten Thesen hat Baxandall durch Beiläufigkeit versteckt: So erwähnt er nur am Rande, daß Pierre Bouguer seine Forschungen zur Reflexivität von Oberflächen in einer Art visueller Grammatik dargestellt habe, die der Malerei verwandt sei. Trotz dieser Nähe fand Bouguer keinen Eingang in die Kunsttheorie, im Gegensatz zu seinem viel weniger an Experiment und Empirie interessierten Kollegen Lambert. Dieser ordnete mathematische und physikalische Wahrheit den Gesetzen der unvermeidlich begrenzten der Perzeption unter und folgte so den Interessen der Maler, die den Schatten durch Beobachtung zu erfassen suchten.
Der Status des Schattens ist im achtzehnten Jahrhundert also ein doppelter: Zum einen wird er als physikalisches Objekt behandelt, zum anderen als Produkt der Wahrnehmung. Baxandall stellt das Wissen über den Schatten als subjektives Phänomen, das die Aufklärung ausformuliert hat, den objektivierenden Verfahren gegenüber, mit denen heute die Computergraphik Erkenntnisse der Forschung zu veranschaulichen sucht. Als Kunsthistoriker kokettiert er mit der Unbefangenheit des disziplinären Außenseiters, doch dem lesenden Laien kann schwindelig werden von der Fachterminologie, die er aufbietet. Lohnt sich die Mühe, den komplizierten Differenzierungen der Schattenarten zu folgen? Offenkundig ließ sich Baxandall bei seinen Beschreibungen mehr von der Faszination für eine fremde Wissenschaft als von der Sache leiten. Denn für seine Fragestellung ist die ausführliche Darlegung der Möglichkeiten und der Probleme des "maschinellen Sehens", wie es der Computer simuliert, nicht notwendig.
Es sind die Maler, die den Sinn einer subjektiven Auffassung des Schattens beweisen. Baxandall zeigt aber auch, wie umgekehrt der Schatten für das Selbstverständnis der Malerei im achtzehnten Jahrhundert bedeutsam wird. Die dichten Thesen im letzten Teil des Buches entschädigen für den mühsamen, unnötig gedehnten und wenig konzentrierten Einstieg, und man bedauert, nicht noch mehr über die malerische Auseinandersetzung mit dem Schatten zu erfahren.
Baxandall endet mit einem ironischen Zweifel, der die Möglichkeit einer objektiven Erforschung des Schattens grundsätzlich in Frage stellt. Denn mit der erhöhten Aufmerksamkeit, die dem Schatten als einem Produkt der Wahrnehmung gewidmet wird, verändert sich das Phänomen.
Michael Baxandall: "Löcher im Licht". Der Schatten und die Aufklärung. Aus dem Englischen von Heinz Jatho. Wilhelm Fink Verlag, München 1998. 208 S., Abb., br., 48,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
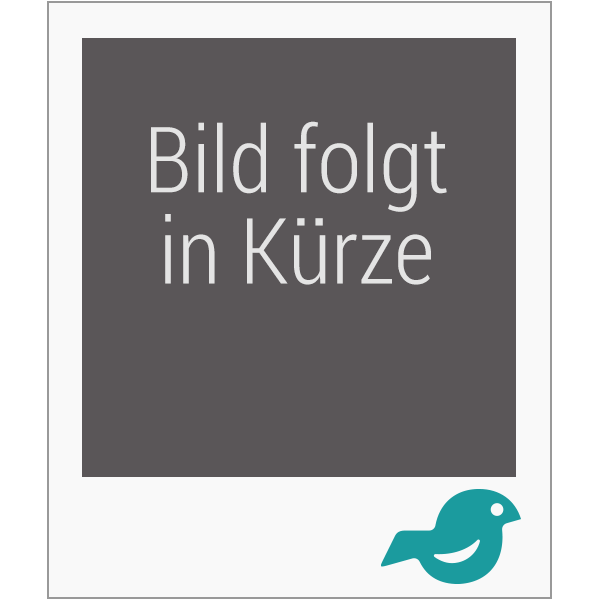




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.10.1998
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.10.1998