der Übersetzerin geht. Lisa Grüneisen beschleunigt das Original zwar ein wenig, macht die Sprache auch jünger und frecher, doch abgesehen von einem unterschlagenen Halbsatz oder der Verwechslung von "scheinbar" und "anscheinend", weiß sie sehr genau, was sie tut.
Die erste Tugend dieses Romans und der kompakten deutschen Übersetzung liegt im lässigen, traumhaft sicheren Zugriff auf die Wirklichkeit. Genauer: auf das, was hier nach zwei, drei Seiten als vollständige Wirklichkeit eines jungen Mannes dasteht. Das Buch handelt von Fran, seinem Leben in einer aseptischen Wohnsiedlung im Madrider Osten und den Entscheidungen, die er nach dem Abschluß der Schule treffen müßte, aber nicht trifft. Clara Sánchez beschreibt Warten, Driften und Träumen als verlängerten Zwischenzustand, dessen Konturen mit fast schmerzhafter Klarheit hervortreten. Frans Mutter hat ein Verhältnis mit ihrem Fitneß-Trainer (Fran nennt ihn "Mister Legs"). Sein Vater ist viel unterwegs und verschwindet irgendwann ganz. Sein bester Freund, Eduardo, hat eine hübsche Schwester, in die Fran sich verliebt. Irgendwann jedoch planen alle Menschen um ihn herum Veränderungen - sie steigen auf, ziehen weiter, gehen fort.
Nur Fran kommt nicht vom Fleck. Er träumt davon, einen Kurzfilm zu drehen, und ist fest entschlossen, nie einen Anzug zu tragen. Statt zu studieren, arbeitet er in der Videothek des Einkaufszentrums und führt in der leerer werdenden Wohnsiedlung die Hunde der Nachbarn aus. Und aus dieser Wartestellung heraus, während die Zeit mit genauso großen Schritten enteilt wie immer, beobachtet er die Welt - wie die Jahreszeiten einander ablösen, wie sich zur Einkaufspassage Minerva das Einkaufszentrum Apollo gesellt, daß seine Mutter heimlich Kokain schnupft (da ist der Fitneß-Trainer längst verabschiedet) und der Busfahrer der Linie 77 immer noch derselbe ist wie fünf Jahre zuvor. Manchmal wirkt Fran ratlos und linkisch (einen "Romantiker" nennen ihn andere), manchmal klüger als seine gesamte Umgebung, fast immer jedoch ist er ein Ritter. Aus so gewöhnlichem Material einen echten Ritter geformt zu haben gehört zu den nicht geringen Verdiensten der Autorin.
Bei den meisten Romanen ist es witzlos, die Handlung nachzuerzählen, so auch bei diesem. Dagegen fällt mehr Licht auf das Buch, wenn man seine literarischen Vorgänger benennt. Es sind Salingers "Fänger im Roggen", Walker Percys "Der Kinogeher" und Richard Fords "Wild Life", allesamt amerikanische Variationen auf den Bildungsroman mit einer besonderen Spezies von verletzbarem Helden, dem sich der Leser fast brüderlich verbunden fühlt. Ebendeshalb wirkt es ja auch unangemessen und töricht, Salingers oder Percys Figuren (wozu die Literaturwissenschaft in moralisierenden Momenten neigt) ihre Charaktermängel vorzurechnen; von "Unreife" oder "spiritueller Leere" ist da die Rede, als hätten passionierte Leser Lust, über literarische Figuren zu Gericht zu sitzen.
Der Held von Clara Sánchez' Roman ist - wie seine amerikanischen Geistesverwandten - ein mit den alltäglichsten Gegenständen ringender Sinnsucher. Seine Expeditionen sind stets ernst gemeint, stürzen aber bisweilen ins Komische, weil Fran von sich selbst ein unvollständiges Bild hat. "Vielleicht sollte ich mir eine richtige Arbeit suchen", denkt er an einer Stelle, "eine, wo man abends kaputt nach Hause kommt und genug verdient, um ein durchschnittlicher Verbraucher zu sein." So sieht sein Materialismus aus, wenn ihm nichts Besseres einfällt. Bei anderer Gelegenheit hängt er an den Lippen von Alien, einem älteren Freund, der Vorträge über die Liebe, die Seele und das Weltall hält: Dann kommt in Fran der Denker zum Vorschein. Clara Sánchez nimmt jede ihrer Figuren ernst; ihre größte Leistung ist, uns das Fühlen eines Neunzehn- und Zwanzigjährigen als lautloses Seelentheater vor Augen zu stellen, teilnahmsvoll, aber auch durch einen hauchdünnen Schleier der Ironie.
Eines Tages ist Eduardo, der zwielichtige Geschäfte treibt, verschwunden. In der geheimen Wohnung seines Freundes stößt Fran auf dessen Freundin Yu, von deren Existenz er nichts ahnte. Das romantische Verhältnis, das sich in der Wohnung entspinnt, überlebt ein paar Wochen und ist das Maximum, was die Autorin ihrem Helden zugesteht. Wir Leser hätten der Erlösung durch die Liebe ohnehin nicht getraut. Auch darin erweist sich Fran als angemessener Vertreter seiner Altersgruppe: Die Verluste erfolgen rasch und ergeben eine längere Liste als die Gewinne.
"Letzte Notizen aus dem Paradies" ist Clara Sanchez' sechster Roman (angefangen hat sie 1989) und ihr erster in deutscher Sprache. Im vergangenen Jahr erhielt sie dafür den Alfaguara-Preis, wie der Klappentext in gebührender Deutlichkeit hervorhebt. Das Buch sei ein "Bestseller in der gesamten spanischsprachigen Welt", heißt es darin weiter. Diese Information ist zumindest irreführend, denn Alfaguara-Preisträger werden nun einmal nicht aus eigenem literarischen Verdienst zum Bestseller, sondern weil der Verlag sie dazu erklärt und den gesamten spanischsprachigen Markt mit seiner Werbekampagne überzieht. Zu den Wettbewerbsbedingungen gehört die Bereitschaft der Autoren, im Fall des Sieges wochenlang durch Lateinamerika zu tingeln, bei Buchpräsentationen zu lächeln und mit eiserner Hand Exemplare zu signieren.
Clara Sánchez hat all das tapfer hinter sich gebracht. Wahr ist auch, daß sie eine würdige Alfaguara-Preisträgerin ist und eine der wichtigsten spanischen Entdeckungen der letzten Jahre. Ihr Buch erzielt den Zaubereffekt jener seltenen, dem Leser ans Herz wachsenden Literatur: das Gewöhnliche mit poetischem Glanz zu versehen und es in unsere Erinnerung zu senken wie eine persönliche Begegnung. Vielleicht meint der weise Alien auch den Leser dieses Romans, wenn er in einem seiner Vorträge sagt: "Wir sind eine Art unter vielen, wenn auch eine, die staunen kann."
Clara Sánchez: "Letzte Notizen aus dem Paradies". Roman. Aus dem Spanischen übersetzt von Lisa Grüneisen. Scherz Verlag, Bern, München und Wien 2001. 252 S., geb., 49,09 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
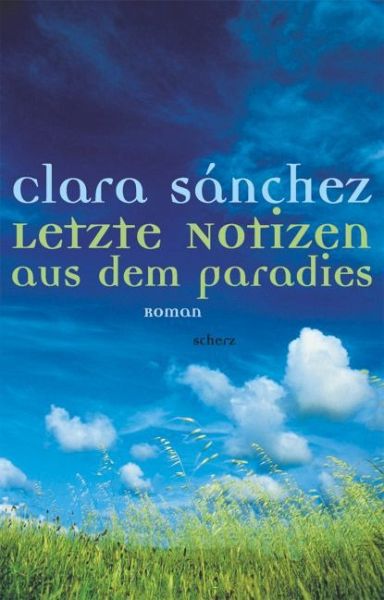




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.2001