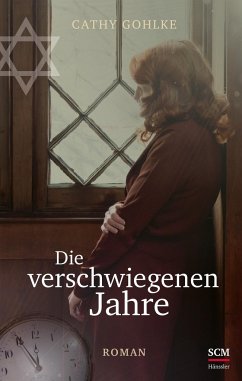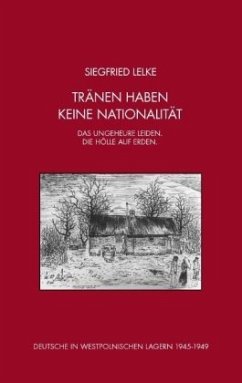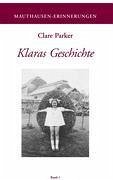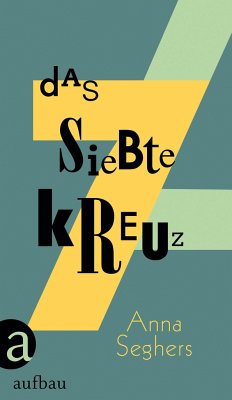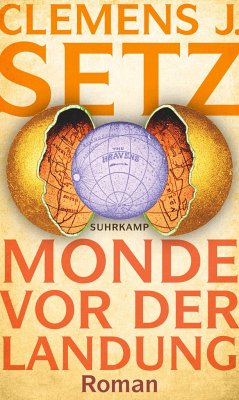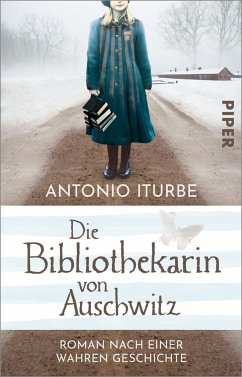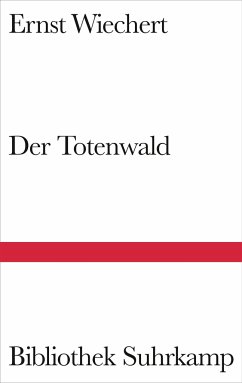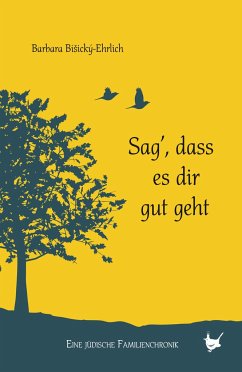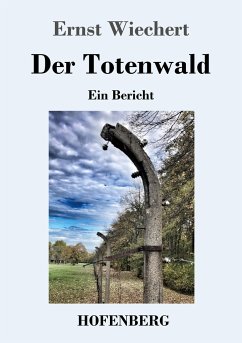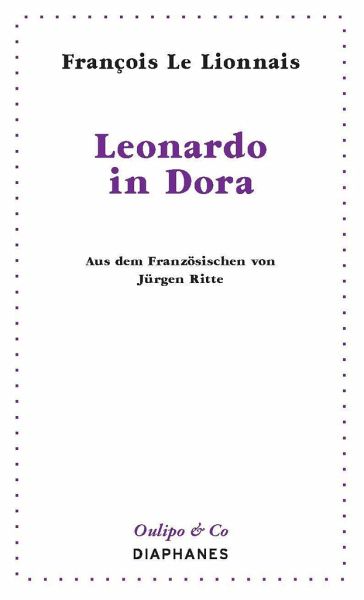
Leonardo in Dora
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
10,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Nachdem François Le Lionnais von der Gestapo verhaftet und in das Konzentrationslager Mittelbau Dora verbracht wurde, wo man ihn mit an deren Häftlingen unter anderem zum Bau der V2 Rakete zwangsrekrutierte, gelang ihm nicht nur das Überleben unter schwersten Bedingungen, sondern auch ein Kunststück der besonderen Art. Trotz der unmenschlichen Umgebung lassen er und seine Kameraden Details, ja ganze Werke der Malereigeschichte in vitaler Präsenz vor dem inneren Auge erstehen. Der Text zeugt von der alles besiegenden Kraft der Imagination und einem mit den Mitteln der Kunst gewonnenen Kamp...
Nachdem François Le Lionnais von der Gestapo verhaftet und in das Konzentrationslager Mittelbau Dora verbracht wurde, wo man ihn mit an deren Häftlingen unter anderem zum Bau der V2 Rakete zwangsrekrutierte, gelang ihm nicht nur das Überleben unter schwersten Bedingungen, sondern auch ein Kunststück der besonderen Art. Trotz der unmenschlichen Umgebung lassen er und seine Kameraden Details, ja ganze Werke der Malereigeschichte in vitaler Präsenz vor dem inneren Auge erstehen. Der Text zeugt von der alles besiegenden Kraft der Imagination und einem mit den Mitteln der Kunst gewonnenen Kampf gegen die Vernichtungslogik des Lagers zugunsten der Freiheit des Geistes.