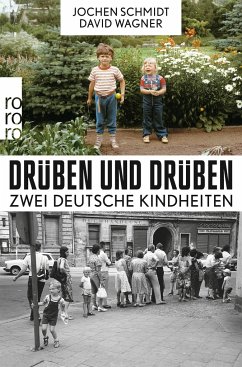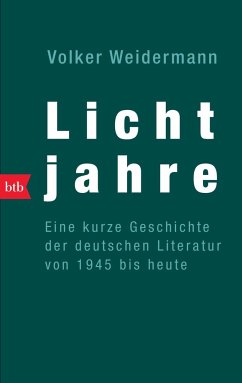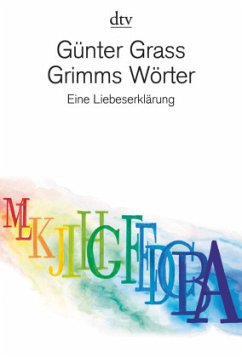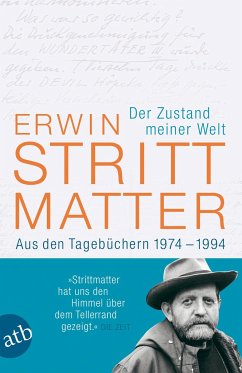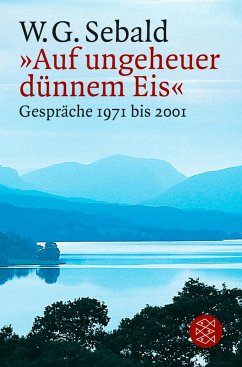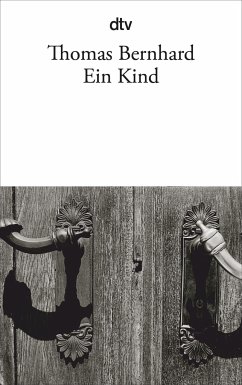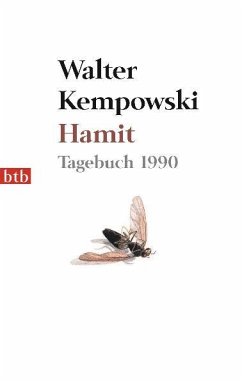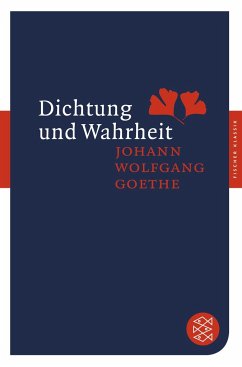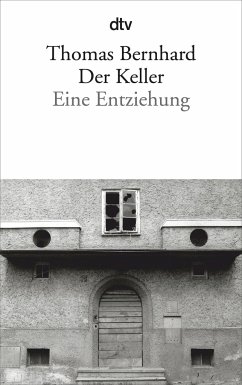Generation an, die wie keine andere des 20. Jahrhunderts in Kindheit und Jugend fortgerissen wurde, gleichviel ob willig oder unwillig. Da nimmt es nicht wunder, daß Härtling der Idee einer Kontinuität des Ich zutiefst skeptisch gegenübersteht: "Es liegen fünfzig Jahre zwischen uns, ein halbes Jahrhundert, und der, mit dem ich mich fragend auseinandersetze, weiß nichts von mir, während ich viel von ihm vergessen, verdrängt habe. Manchmal muß ich ihn erfinden, wenn ich nichts finde, manchmal erzähle ich ihn um." Nicht einmal die Wahrheit des subjektiven Erlebens ist gesichert, geschweige denn die Tatsächlichkeit eines Ich. Im autobiographischen Schreiben entsteht vielmehr ein neues Erleben, in dem allenfalls das Leid eine Kontinuität hat: "Alte, vergessene Wunden beginnen wieder zu schmerzen."
Die Wahrhaftigkeit der Selbsterkundung ist für Härtling gerade darin gegeben, daß sich die Gedankengewohnheit eines mit sich selbst identischen Ich im Prozeß des erinnernden Schreibens auflöst: "Ich sage ich, und das Ich entfaltet ein Echo, aus dem ein Ich nach dem anderen springt und wieder verstummt, verschwindet. Alle meine Ichs. Mit ihnen erkunde ich meine Unrast, meine Verwandlungen, meine Verluste und Bereicherungen." Für Härtling ist das nicht lediglich eine Frage des Erinnerungsvermögens und der Erzähltechnik, sondern hat eine politische und moralische Dimension. Kaum je mußte eine Generation die früh gebildeten Ideale so schnell wieder in Frage stellen. So fragt sich Härtling, ob er es denn gewesen sein kann, der seine Freiheit darin sah, für den Führer zu sterben. Die idealistische Seite der nationalsozialistischen Jugendpolitik stellt er einläßlich und redlich dar, zu den "Überlebenslügnern" will er bei aller Einsicht in die Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses nicht gehören. Das grenzt freilich im Rückblick auf die Wahrnehmung des Flüchtlingskindes von 1946 sachte an mnemotechnisches Pharisäertum: "Schon erzählte jeder seine Geschichte um, mehrten sich die Widerstandskämpfer gegen Hitler, schon baute jeder auf die vorsätzliche Vergeßlichkeit des anderen."
Aber Härtling macht ebenso deutlich, daß er die aufrechte Haltung und das Neinsagen nicht allein sich selbst und der eigenen Erfahrung der Nazizeit verdankt, sondern daß er sie an der Literatur, zunächst vor allem aus dem Pathos eines Wolfgang Borchert, erlernt und eingeübt hat. Fortan umgibt ihn selbst die Aura des Literaten und läßt ihn ruhig ertragen, was für seine bildungsbürgerlich denkende Familie "ein soziales Debakel" ist: der Abgang vom Gymnasium und die Tätigkeit als Bürobote in einer Korkenfabrik. Gerade so aber wird Härtling in der beengten schwäbischen Provinz die Literatur zur Sphäre unbegrenzter sinnlicher Erfahrung. "Ich atmete Meer ein, ließ mich von Albatrossen tragen, grub mich ins Fleisch von schwarzen Huren, las Rimbaud, Baudelaire . . ." Die Öffnung zur Welt vollzieht sich dann für den jungen Volontär der "Nürtinger Zeitung" durch Werk und Person Helmut Heißenbüttels, zugleich findet er im "Yamin" seiner frühen Gedichte ein Ich, mit dem man sich davonstehlen kann. Die Bücher der literarischen Heroengeschichte der Bundesrepublik, sie werden bei Härtling aufgestellt wie Gedenktafeln, auf denen auch das Leiden verzeichnet ist. Aus einem Brief Celans überliefert er: "Unsere Begegnung damals - wann? - in Stuttgart: unser Schmerz hat gelacht, wir haben uns verstanden."
Es sind die Zeiten der Anfänge, der Aussichten und der Übergänge, an die sich Härtling am lebhaftesten erinnert. Mit Hans Bender und Heinrich Vormweg will er bei der "Deutschen Zeitung" "das beste Feuilleton machen, ein Forum für Kenner und Leidenschaftliche". Beim "Monat" im frisch eingeschlossenen West-Berlin genießt er noch einmal die Euphorie des Anfangens, der erneuten Öffnung der Welt in den "Erinnerungen der Weitgereisten", die sich in den Sechzigern in Berlin einfinden.
Er sieht sich als einen rezeptiven Geist, aber auch als Betriebsnudel. Wo etwas losgeht, ist Härtling dabei. Er kennt sie alle, und fast alle werden erwähnt, was die Lektüre streckenweise mühselig macht, denn manche stehen da nur in der Reihe auf dem Papier herum. Zu Personen werden die berühmten Namen am besten in den Anekdoten der Berliner Geselligkeit. Wenn Härtling berichtet, wie er und Peter Szondi mit ihren Armen ein "Sitzchen" formten und, selbst vom Weine beseligt, die trunkene Ingeborg Bachmann zu ihrem Nachtquartier trugen, wäre man gern dabeigewesen. Sich einhaken ist überhaupt ein bei Härtling wiederkehrender Ausdruck des Verbindens. Dabei hat er über niemanden wirklich Böses oder Hämisches zu berichten. Fast scheint es, als hätte er die Maxime des Büroboten beibehalten: "in freundlichem Gleichmaß die Verbindung zwischen Vorgesetzten - und alle sind Vorgesetzte - aufrechtzuerhalten".
Die leitende Tätigkeit beim S. Fischer Verlag nimmt in dem Buch merkwürdig geringen Raum ein, obwohl sich Härtling gerade da eine aktivere Rolle im Kulturbetrieb zuschreibt. Sein Ich der Zeit von 1967 bis 1973 erscheint ihm "so entfernt wie nie vorher oder nachher. Es steckt so fest in seiner Rolle, die ich schon nicht mehr spielen mochte. Der Mann von fast vierzig. Ein Macher. Auch ein Mächtiger, obwohl ihm Macht nicht geheuer ist." Mechthild, seine lebenslange Liebe, die in den Aufzeichnungen auf rührendste Weise präsent ist, sagt da einmal mehr: "Versuch's." Härtling kündigt und probiert wieder Anfänge, die aber, so suggeriert zumindest das Verhältnis von Fern- und Naherinnerung, schon den Übergang zum Alter markieren. Auch in den letzten Seiten aber, in denen die Gegenwart des alten Mannes mit seinen Zipperlein und Mühseligkeiten in den Vordergrund rückt, hebt Härtling noch die Momente von Anarchie und Aufbruch hervor, wenngleich die gelegentlich nur noch als Schülertheater stattfinden. Aber auch das sind für Härtling leidenschaftliche Momente des "Noch einmal", Momente eines Lebens aus und mit der Literatur und der Liebe.
Peter Härtling: "Leben lernen". Erinnerungen. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2003. 378 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main







 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.11.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.11.2003