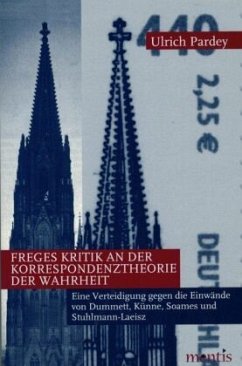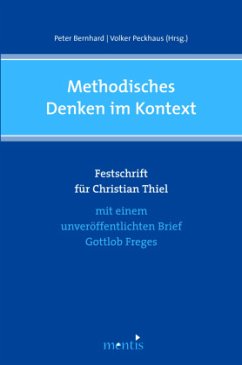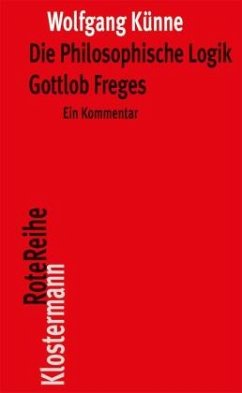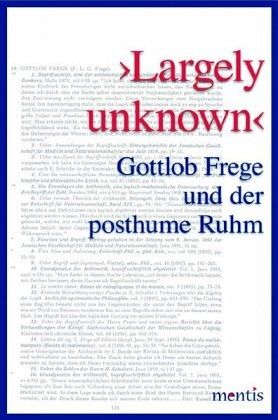
'Largely unknown'
Gottlob Frege und der posthume Ruhm
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
42,90 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Gottlob Frege war einst ein kaum bekannter intellektueller Einzelgänger. Als er verstarb, nahm niemand davon Notiz. Er schien vergessen. Doch kein Vierteljahrhundert später ist er der größte Logiker seit Aristoteles, sein philosophisches Werk von epochaler Bedeutsamkeit. Aus dem akademischen Außenseiter wurde ein Heroe der Wissenschaftsgeschichte. Wie kam es indes zu Freges posthumer Geburt? Die vorliegende Untersuchung erzählt diese außergewöhnliche Geschichte in all ihren faszinierenden Details und hält so manche Überraschung bereit. Die bibliographischen Koordinaten JSL 1(4), 135 ...
Gottlob Frege war einst ein kaum bekannter intellektueller Einzelgänger. Als er verstarb, nahm niemand davon Notiz. Er schien vergessen. Doch kein Vierteljahrhundert später ist er der größte Logiker seit Aristoteles, sein philosophisches Werk von epochaler Bedeutsamkeit. Aus dem akademischen Außenseiter wurde ein Heroe der Wissenschaftsgeschichte. Wie kam es indes zu Freges posthumer Geburt? Die vorliegende Untersuchung erzählt diese außergewöhnliche Geschichte in all ihren faszinierenden Details und hält so manche Überraschung bereit. Die bibliographischen Koordinaten JSL 1(4), 135 führen zum Schlüssel des Rätsels.
Aus der Presse:
This [...] book should be of interest to all students of the history of analytic philosophy or modern logic. (Ansten Klev in Philosophica Mathematica, Vol. 28, Issue 1, Februar 2020)
Aus der Presse:
This [...] book should be of interest to all students of the history of analytic philosophy or modern logic. (Ansten Klev in Philosophica Mathematica, Vol. 28, Issue 1, Februar 2020)
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.