Erzählungen aus dem Band, oder besser, so heißt sie jetzt. In einer früheren Ausgabe, die ebenfalls Andreas Oplatka als Übersetzer nennt, war Lapaj noch ein "Dudelsackpfeifer" gewesen. An dem Instrument, das Lapaj wie kein zweiter spielt und mit dem der menschenscheue Feldhüter sich ein Zubrot zu verdienen pflegt, hat sich nichts geändert. Es ist und bleibt ein Dudelsack, und wir können nur raten, welche translatologische Erwägung ihn zum schlichten "Sack" verkürzt hat.
Was ist von einer Erzählung mit dem Titel "Lapaj, der berühmte Sackpfeifer" zu erwarten? Biederkeit und Folklore, möchte man antworten. Nichts anderes, als man hinter einem Titel wie, sagen wir, "Pankraz der Schmoller" vermuten würde, hinter dem sich dann allerdings doch Kunst versteckt. Kaum anders verhält es sich mit Kálmán Mikszáths "Lapaj". Dies ist eine ethnographisch ergiebige, psychologisch wache, stilistisch gekonnte und menschlich anrührende Novelle. Ihr Einfluss, wie der von Mikszáths frühen Erzählungen überhaupt, auf die ungarische Kurzprosa des zwanzigsten Jahrhunderts ist, wie Andreas Oplatka in seinem Nachwort betont, erheblich.
Es geht in dieser wie in den anderen Geschichten von den "slowakischen Vettern" im Kern um einen Handel. Lapajs, des eigenbrötlerischen Feldhüters, einziger Besitz ist sein Dudelsack. Für seine berühmte Sackpfeife hat ihm einer schon hundert Taler angeboten, doch Lapaj will sie um keinen Preis verkaufen. Mit ihr spielt er auf allen besseren Hochzeiten rings herum zum Tanz auf, und "seine berühmten Lieder", heißt es, "haben schon die Fußsohlen vieler hübscher Mädchen gekitzelt". Was Lapaj selbst betrifft, so hat er "nie jemanden geliebt. Kein Mädchengesicht hat in diesem irdischen Leben je auf ihn Eindruck gemacht." Sollte allein Lapaj, der gefühlvollste aller Musikanten, "nicht fühlen, nicht denken, nicht lieben"? So sieht es aus.
Eines Nachts begegnet Lapaj am Fluss einer jungen Frau. Sie redet wirres Zeug und stürzt sich dann in die Fluten. Lapaj sendet ihr ein Gebet hinterher und begreift erst dann ihre Reden. Die Frau hat ihm in seiner Feldhüterhütte ein Findelkind hinterlassen. Nun geschieht das Ungeheuerliche: Der Griesgram Lapaj verwandelt sich in einen hingebungsvollen Pflegevater, der für eine Ziege, zwei Kissen und Matratze sein einziges Hab und Gut, die legendäre Sackpfeife, hergibt.
Den plötzlichen Einbruch der Menschenliebe in die selbstgenügsame Existenz des Sackpfeifers Lapaj beschreibt Mikszáth mit freundlicher Ironie und einem offenen Ohr für die mündliche Überlieferung aus der Welt seiner Figuren. Den Gestus des mündlichen Erzählens überführt er so geschickt in die eigene Erzählweise, dass man als Leser unweigerlich zum Hörer einer Erzählung wird, die von ihren Hirten und Musikanten die Töne bewahrt, auf ihre Naivität aber mit erzählerischem Kalkül antwortet.
CHRISTOPH BARTMANN
Kálmán Mikszáth: "Lapaj, der berühmte Sackpfeifer". Erzählung. Aus dem Ungarischen übersetzt und mit einem Nachwort von Andreas Oplatka. Manesse Verlag, Zürich 1999. 78 S., geb., 19,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
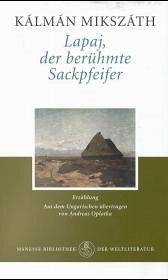




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.02.2000
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.02.2000