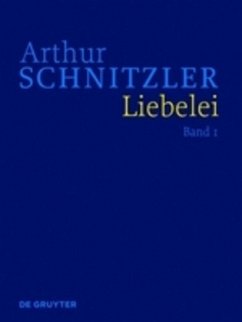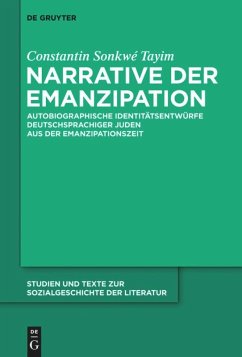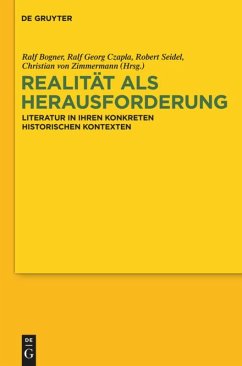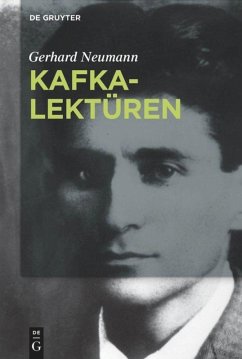und noch der eine oder andere Held, der sich in der Gralssuche oder im Turnier hervortun darf.
All dies hat sich erst im Laufe der Zeit aus dürftigen Anfängen und einem großen Fundus an literarischen und sagenhaften Motiven entwickelt. Weil es dabei kaum ohne Widersprüche zwischen den Texten abging, ist jede Nachdichtung der Artusgeschichte auch eine Entscheidung für oder gegen andere Überlieferungen und deren Bild von den Rittern. So kennt man etwa Lanzelot als problematischen Musterritter, der sich als Krieger für Artus in die Bresche wirft und sich gleichzeitig in die Frau seines Königs verliebt, der gegen seine Leidenschaft ankämpft und doch immer bereit ist, Ginovers Ehre gegen jedermann mit dem Schwert zu verteidigen. Die Wucht der Texte, die dieses Bild zeichnen, ist erdrückend: Der "Karrenritter" des Chrétien de Troyes (um 1170), der starkleibige "Prosa-Lancelot" (nach 1250) und andere scheinen den Ritter mit dem großen Herzen und der breiten Brust eindeutig auf diese Rolle festzulegen.
Einzig der erstaunliche "Lanzelet" des ansonsten nicht weiter in Erscheinung getretenen Ulrich von Zatzikhoven hält dagegen. Der Roman, entstanden nach 1194 und auf der Basis einer nicht überlieferten Vorlage, umfaßt knapp 9500 Verse und weist durchaus eine Verwandtschaft mit dem späteren "Prosa-Lancelot" auf: Der Held wächst nach dem Tod seines Vaters und dem Verlust des Reiches bei einer Meerfrau unter lauter Damen auf. Seinen Namen kennt er nicht, er muß ihn sich erst im Kampf verdienen. Auch seine besondere Beziehung zur Königin Ginover (Genover) deutet sich an, und natürlich ist auch er ein ganz herausragender Ritter.
Nur vom Ehebruch weiß dieser Roman nichts und markiert damit die Linie zwischen hoher und niederer Minne; weil der Karrenritter Lanzelot, anders als Ulrichs Lanzelet, die Sphären nicht zu trennen weiß, ist er seit je der problematischere Held, der interessantere, der die Artuswelt mittelbar zum Einsturz bringt. Lanzelet aber, der eine Fülle von amourösen Abenteuern erlebt, bleibt am Ende bei der Dame Iblis, die in sittlicher Hinsicht noch über der Königin steht. Das erweist sich bei einer öffentlichen Tugendprobe am Artushof, bei der die anwesenden Damen nacheinander einen verzauberten Mantel anziehen müssen, der sich seinen Trägerinnen in dem Maße anpaßt, wie es deren Sittsamkeit entspricht. Die Königin, die ihn als erste anprobiert, muß erleben, daß ihr der Mantel nur bis zum Knöchel reicht - ein Zeichen zwar für körperliche Treue, aber auch für Gedankensünden der Dame, und Artus wird nun öffentlich darüber belehrt, er möge besser sorgfältig auf seine Frau aufpassen. Nur Lanzelets Freundin Iblis paßt der Mantel wie angegossen.
Daß es Lanzelet mit der Treue selbst nicht so genau nimmt, steht auf einem anderen Blatt. Mehr noch als sein ehebrecherischer Namensvetter nimmt er Dinge leicht, gefeit gegen alles Üble, und zwar im Wortsinn, denn es ist offensichtlich die Jugendzeit bei der Meerfee, die ihm zu dieser Disposition verhilft. Wer unter zehntausend Frauen der einzige Mann ist, wird auch später auf sein Glück, auf seine "saelde", vertrauen. Selbst als er im Turmverlies des finsteren Linier hockt, ist er provozierend guter Dinge - weiß er schon, daß ihm Ade, Liniers schöne Nichte, hinaushelfen wird? Der Burgherr staunt in seinem Zorn auf den Gefangenen über dessen einfältige Zuversicht und nimmt ihn verhängnisvollerweise nicht ganz ernst.
Lanzelets Werdegang aber ist so anders als der seiner arturischen Brüder, so uninteressant reibungsarm, daß sich der Roman unter Mediävisten keiner großen Zustimmung erfreut: Wo Erec, Iwein oder Parzival erst aufsteigen, um dann krachend niederzustürzen und sich dann langsam wieder zu berappeln, fehlt dieser Bruch bei Lanzelet. Spannender als der Held ist da die Topographie der Traumwelt, in die er reitet, Orte wie die "wachsende Warte", ein Hügel, der die Wahrnehmung verzerrt, oder das "schreiende Moor", das kaum zu überqueren ist. Liebenswerte Randfiguren kommen hinzu, etwa jener arme Held namens "Maurin mit den hellen Schenkeln", der voller Tatendrang in den Roman hineinreitet, nur um elf Zeilen später gedemütigt und als Gefangener wieder hinauszustolpern. Frau Ade wird man nicht missen wollen, die sich erst auf die Seite Lanzelets stellt und dafür ihren Onkel aufgibt, die sich im Glanz des Geliebten sonnt und dann doch an ihm zweifelt und darüber wahnsinnig wird. Und auch Frau Iblis gewinnt neben Lanzelet an Statur.
Wer den Roman bisher lesen wollte, war auf eine Ausgabe aus dem neunzehnten Jahrhundert oder die zweifelhafte Übersetzung von Wolfgang Spiewok angewiesen. Nun ist eine zweibändige zweisprachige Ausgabe erschienen, die philologisch allen Ansprüchen genügt, die man vernünftigerweise an ein solches Unterfangen stellen kann, die sorgfältig und umfangreich kommentiert ist und deren Apparat die bisherige Forschung gut erschließt. Daß die Übersetzung des Herausgebers Florian Kragl manchmal etwas ängstlich dicht am Lautstand des Originals bleibt, wird man verschmerzen; daß Kragl, wo es im Mittelhochdeutschen "degen" oder "veter" heißt, auch "Degen" und "Vetter" übersetzt, vielleicht auch, selbst wenn dort "Held" und "Onkel" gemeint sind.
Denn mehr als eine Hinführung zum Original will diese Übersetzung kaum sein. Kragls Edition erschließt damit den Raum, den künftige Bearbeiter, Nachdichter oder eben auch Übersetzer nutzen können. Und eine stärkere Rezeption hat dieses Werk vom glücklichen Zwilling des unglücklichen Lancelot allemal verdient.
Ulrich von Zatzikhoven: "Lanzelet". Hrsg. und übersetzt von Florian Kragl. Verlag Walter de Gruyter, Berlin und New York 2006. 2 Bde., zus. 1389 S., geb., 1 CD-Rom, 248,- [Euro] (ab 1. 1. 2007: 298,- [Euro]).
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
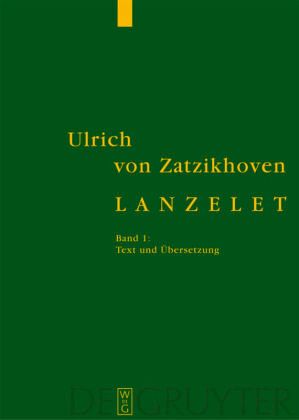





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.12.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.12.2006