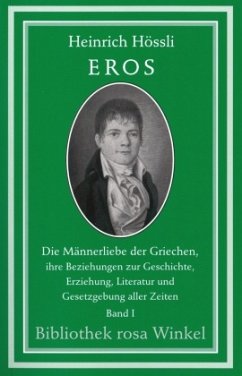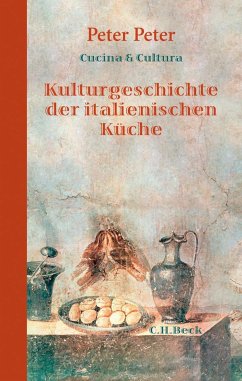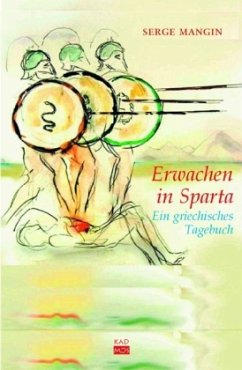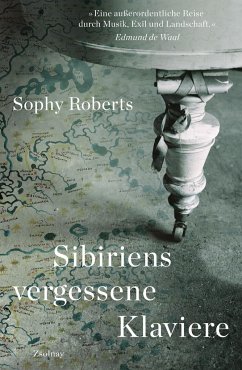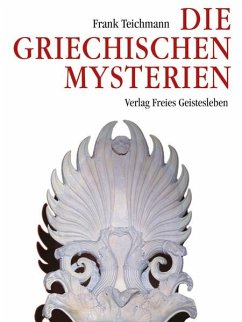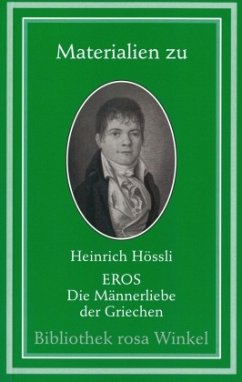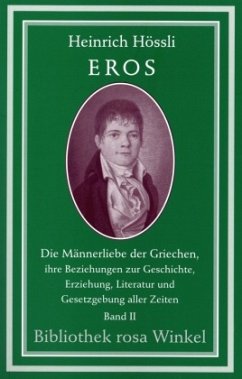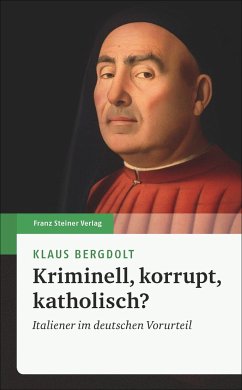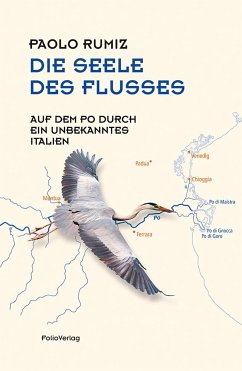und Toscana seit seiner Jugend viel bewandert, aber "als er Papst wurde, wandte er seine Muße in der guten Jahreszeit wesentlich auf Ausflüge und die Landaufenthalte. Jetzt wenigstens hatte der längst podagrische Mann die Mittel, sich auf dem Tragsessel über Berg und Tal bringen zu lassen."
Ständig diese Picknicks!
In seinen autobiographisch geprägten "Commentarii" schilderte der Papst selbst sein Erleben. Er nannte sich, auf seinen Namen anspielend, "silvarum amator et varia videndi cupidus" (einen Liebhaber der Wälder und immer begierig, das mannigfaltig Bunte anzuschauen), genoss die Natur und betrachtete mit nüchterner Neugier die von der Vegetation umrankten Baureste der Antike. "Dies ist wesentlich moderner Genuss", urteilte Burckhardt, "nicht Einwirkung des Altertums. So gewiss die Alten ähnlich empfanden, so gewiss hätten doch die spärlichen Aussagen hierüber, welche Pius kennen mochte, nicht hingereicht, um in ihm eine solche Begeisterung zu entzünden."
Trotzdem haben Philologen und Literaturhistoriker, beeindruckt durch Eneas Wortgebrauch klassischer Autoren, die authentische Empfindung des Papstes gelegentlich in Zweifel gezogen. Kongenial mit Burckhardt wendet sich Arnold Esch, der gelehrte Liebhaber Italiens, in einer schönen Studie gegen diese Unterstellung. Der Historiker führt zahlreiche Parallelbelege zu den "Commentarii" an, vor allem aus Rechnungsbüchern des päpstlichen Haushalts und Briefen von Teilnehmern an den Ausflügen, Besichtigungen und Mahlzeiten im Freien. Überreiche Zeugnisse bietet etwa die Korrespondenz des jungen Kardinals Gonzaga und seines Gefolges mit seinen Eltern. Bei den Kastanien des Monte Amiata wird mit der Stimmung auch das poetische Talent bei einem Hausgenossen des Kardinals entfacht: "Ich glaube, es gibt in Italien keinen schöneren Platz. Kaum ist man aus der Tür heraus, betritt man einen Kastanienwald, der mehr als sechs Meilen lang nicht aufhört. Die Bäume sind so hoch, wie man überhaupt sehen kann. Der Waldboden ist grasbewachsen und sauber wie eine gemähte Wiese. Viele klare Quellbäche fließen da, es weht immer ein Lüftchen durch diesen Wald, so dass man keine Hitze spürt."
Pius II. und sein Gefolge sahen, hörten, rochen, schmeckten und ertasteten aber nicht bloß die Natur, sondern der Pontifex erledigte auf Wiesen oder unter hohen Bäumen, besonders gern an fließendem Wasser oder in verfallenen Klöstern mit grandiosem Ausblick, die Routinegeschäfte seines Amtes. Wenn er sich den Genuss der Natur aber nicht stören lassen wollte, unterzeichnete er keine Bittschriften und wies Gesandte ab. So kommen bei Esch auch diejenigen zu Wort, die unter der unberechenbaren Mobilität der päpstlichen Familia litten, wie der Prokurator der Stadt Lübeck, der sich am Monte Amiata Pius wochenlang vergeblich zu nähern suchte, um die Ausfertigung einer Urkunde zu erwirken.
Und während der Piccolomini das frugale Mahl im Freien schätzte, vermissten die Standesbewussten in seiner Umgebung Luxus und Stil. Der französische Kardinal Alain Coëtivy, enerviert von den ständigen Picknicks, leistete es sich etwa, bei den adligen Orsini in Campagnano anstelle des Papstes ein für diesen vorbereitetes Festmahl selbst einzunehmen, während Pius bei Bauern der Umgebung um Brot und Zwiebeln bat. Und erst recht murrten die Kurialen über zu viel Natur und einfaches Landleben. Kein Zweifel: Burckhardts Urteil, dass Enea Silvio den Normalmenschen seiner Zeit repräsentiert, gilt nicht für alle Schichten der Bevölkerung im gleichen Maße.
Neben den schriftlichen Seitenzeugnissen ist es Esch gelungen, entsprechende Kunstwerke für die neue Sicht auf Natur und Landschaft zu präsentieren. Diese reichen tatsächlich bis ins Alltagsgeschehen. Amüsiert berichtet Pius einmal davon, wie sich seine Höflinge und die Kardinäle Ende Januar 1460 im winterlichen Apennin mit Schneebällen bewarfen. Esch bietet dazu das fast zeitgenössische Fresko aus einem Turm des Castello del Buonconsiglo in Trient auf, wo sich eine vornehme Familie eine Schnellballschlacht liefert. Anders als die Kardinäle ließen sich die Herrschaften die Geschosse freilich nicht anreichen, sondern formten sie mit eigener Hand!
Vom Meister der Miniatur
Wie Mantegna etwas später römische Ruinen vom Gebüsch überwuchert malen sollte, hat Pius II. die antiken Überreste von Vegetation umfangen besonders geliebt. Als er die Via Appia in Richtung Lago di Nemi nahm, schrieb er, "die Natur, die höher ist als alle Kunst", habe die Straße wunderschön gemacht. Auch die Überreste der griechischen Antike haben bekanntlich vor allem Italiener entdeckt, nachdem Manuel Chrysolaras 1397 auf den Lehrstuhl des Griechischen in Florenz berufen worden war. In einer zweiten Untersuchung zeigt Esch am Beispiel Buondelmontis und des Cyriacus von Ancona, dass auch hierbei die Landschaft mit allen Sinnen wahrgenommen und die antiken Reste in ihrer natürlichen Umgebung beschrieben wurden.
Arnold Esch bietet in seinem schmalen Buch zwei wirkliche Essays, Narratives mit Wissenschaftlich-Diskursivem vermischt. Er ist, man weiß es längst, ein Meister der Miniatur, wie es in der deutschen Geschichtswissenschaft der Gegenwart keinen zweiten gibt. Und trotzdem verraten seine Sätze - oft zum Bersten angespannt mit Partizipien und Parenthesen, um die Weite der Welterfahrung und gelehrte Analogien einzufangen -, wie der Forscher der Erzählfreude des Historiographen Fesseln anlegt.
Schon ist ein weiterer Sammelband seiner Aufsätze angekündigt, von denen es schon mehrere - und wertvolle - gibt. Damit Ferdinand Gregorovius' "Geschichte der Stadt Rom" aber nicht das letzte einschlägige Werk von Rang bleibt, brauchten wir von Arnold Esch noch eine große Darstellung des italienischen Mittelalters.
MICHAEL BORGOLTE
Arnold Esch: "Landschaften der Frührenaissance". Auf Ausflug mit Pius II. Verlag C. H. Beck, München 2008. 128 S., 25 Abb., br., 14,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
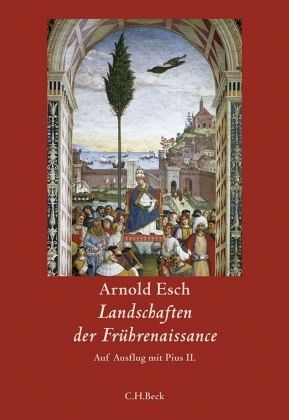






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.01.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 14.01.2008