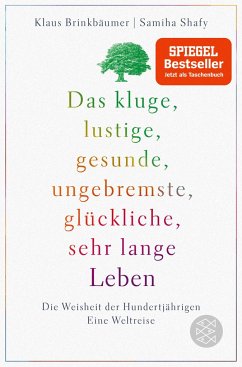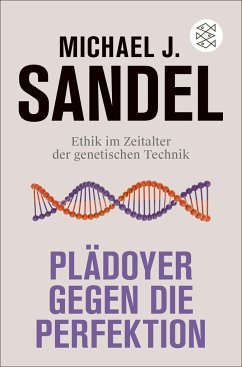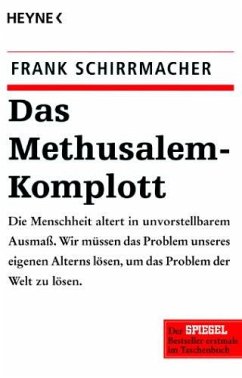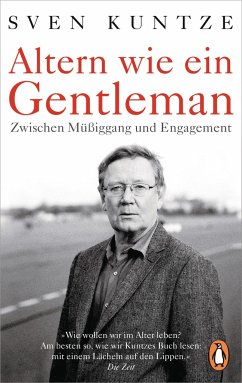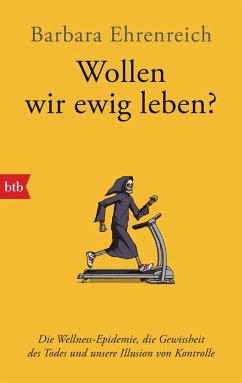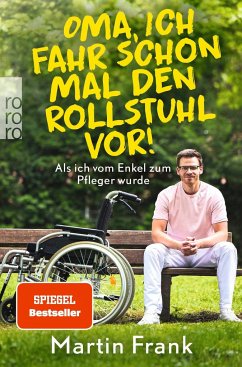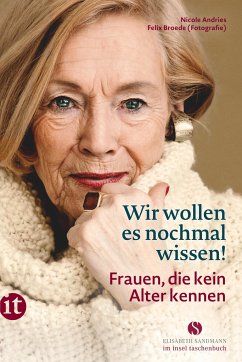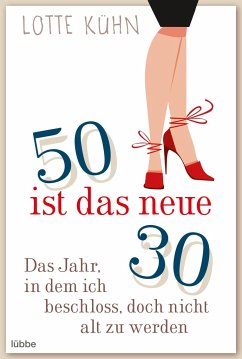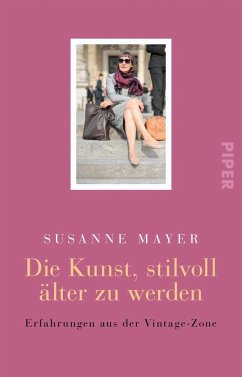Länger leben?
Philosophische und biowissenschaftliche Perspektiven
Herausgegeben: Knell, Sebastian; Weber, Marcel
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
12,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Biowissenschaftler an diversen Orten dieser Welt spekulieren heute über die zukünftige Möglichkeit, den Menschen langsamer altern zu lassen, und suchen nach praktischen Wegen, die menschliche Lebensspanne erheblich auszudehnen. Aber wäre ein längeres Leben wirklich ein besseres Leben? Welche Auswirkungen hätte dies für die Gesellschaft im ganzen? Und wie ungerecht wäre es, wenn lebensverlängernde Therapien etwa das Privileg Wohlhabender blieben?Der interdisziplinär angelegte Band bietet erstmals für das deutschsprachige Publikum einen Überblick über die zentralen Aspekte der bishe...
Biowissenschaftler an diversen Orten dieser Welt spekulieren heute über die zukünftige Möglichkeit, den Menschen langsamer altern zu lassen, und suchen nach praktischen Wegen, die menschliche Lebensspanne erheblich auszudehnen. Aber wäre ein längeres Leben wirklich ein besseres Leben? Welche Auswirkungen hätte dies für die Gesellschaft im ganzen? Und wie ungerecht wäre es, wenn lebensverlängernde Therapien etwa das Privileg Wohlhabender blieben?Der interdisziplinär angelegte Band bietet erstmals für das deutschsprachige Publikum einen Überblick über die zentralen Aspekte der bisher vor allem in der angelsächsischen Welt geführten Debatte zum Thema Lebensverlängerung. Philosophen, u. a. John Harris, Leon Kass und Peter Singer, und renommierte Biowissenschaftler, darunter David Gems und Michael R. Rose, diskutieren darin aus unterschiedlichen Perspektiven das Projekt eines radikalen Anti-Ageing.