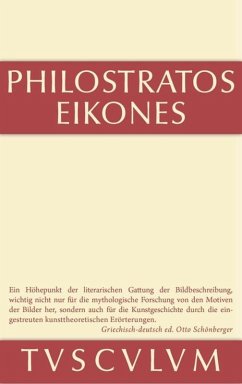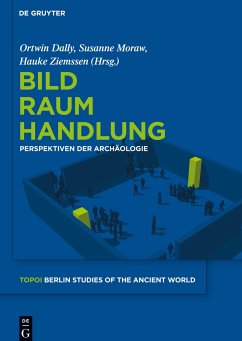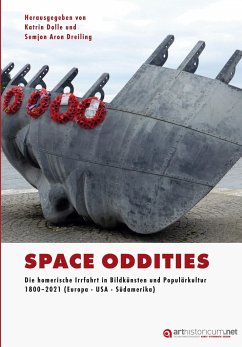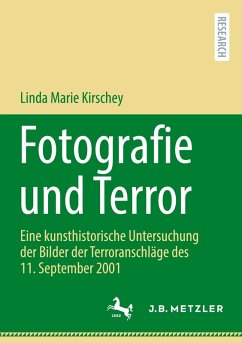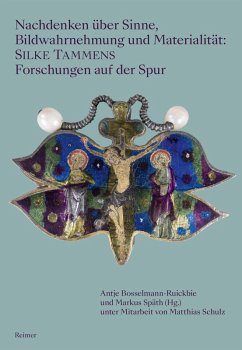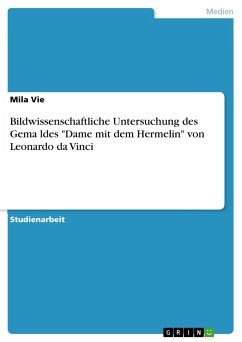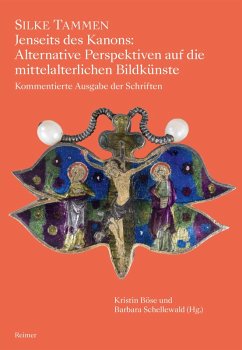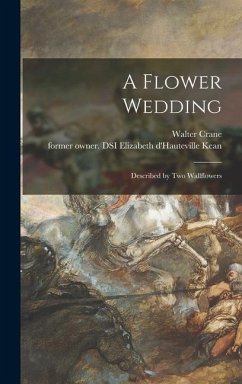La Galeria
Italienisch-Deutsch
Mitarbeit: Kruse, Christiane; Stillers, Rainer;Übersetzung: Kruse, Christiane; Stillers, Rainer; Ott, Christine
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 6-10 Tagen
28,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Giambattista Marino (1569-1625), der berühmteste italienische Barockdichter, war schon zu Lebzeiten als "Dichter der fünf Sinne" ein gefeierter Poet in den Kunstzentren Italiens und am Hof des französischen Königs. Die einzigartige Sprachkunst Marinos und seine gebildete Weltläufigkeit zeichnen sich wohl am unmittelbarsten in La Galeria (1619), einem Zyklus von über 600 "Bildgedichten" über größtenteils bis heute berühmte Werke der bildenden Kunst, u.a. von Tizian und Rubens, Reni oder Caravaggio. Klassische Bildthemen aus Bibel und Mythologie sowie historische und zeitgenössische H...
Giambattista Marino (1569-1625), der berühmteste italienische Barockdichter, war schon zu Lebzeiten als "Dichter der fünf Sinne" ein gefeierter Poet in den Kunstzentren Italiens und am Hof des französischen Königs. Die einzigartige Sprachkunst Marinos und seine gebildete Weltläufigkeit zeichnen sich wohl am unmittelbarsten in La Galeria (1619), einem Zyklus von über 600 "Bildgedichten" über größtenteils bis heute berühmte Werke der bildenden Kunst, u.a. von Tizian und Rubens, Reni oder Caravaggio. Klassische Bildthemen aus Bibel und Mythologie sowie historische und zeitgenössische Heroen und Geistesgrößen sind in dieser idealen Kunstgalerie versammelt. In ihrer poetischen Beschreibung des intensiven Kunsterlebens und gelehrten Kunstgenusses ist La Galeria unerreicht. Die vorliegende Auswahl aus dem Gesamtzyklus ist die erste Ausgabe der Galeria in deutscher Sprache.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.