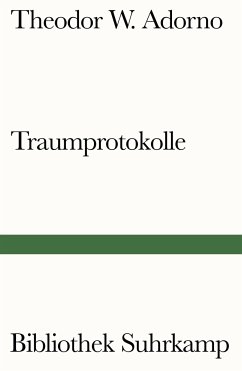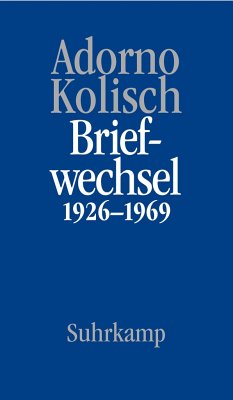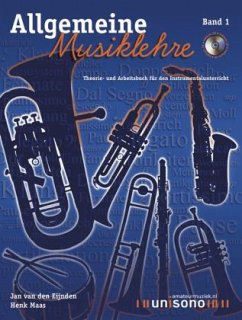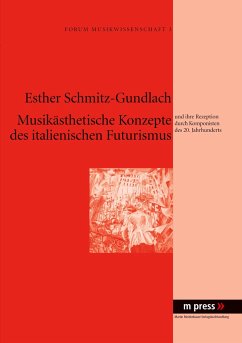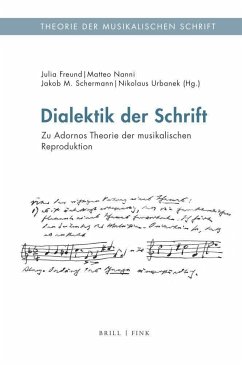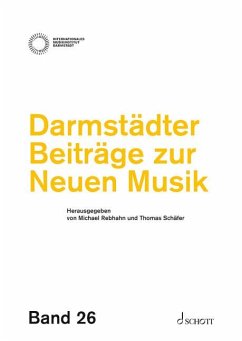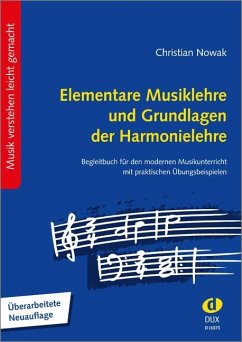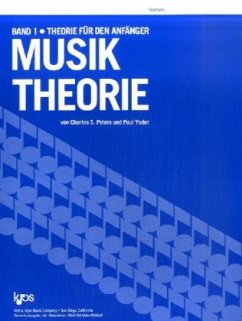hervortritt: Der Komponist, der philosophiert, und der Philosoph, der komponiert, verkörpern verschiedene Diskurse, die verschieden bleiben. Künstlerästhetik heißt der eine, Philosophie der andere. In Adornos Brust schlagen beide Herzen.
Prima vista könnte man meinen, inhaltlich biete der Band nichts Neues. Aber dem Tunnelblick des Experten geht das Beste verloren. Sicher erschien die wahrhaft überreiche Vorlesung zur "Funktion der Farbe in der Musik" von 1966 bereits 1999 (unkommentiert) in einem Band der "Musik-Konzepte". "Schönbergs Kontrapunkt" (1956), "Kriterien der Neuen Musik" (1957) und "Vers une musique informelle" (1961) gar liegen seit Jahrzehnten als minutiös ausgearbeitete Abhandlungen in den Gesammelten Schriften vor. Materialiter gehen sie auf die entsprechenden Vorlesungen zurück, ihre ästhetische Perspektive jedoch weist zum Teil weit darüber hinaus. Diese Texte stellen heute Adornos Philosophie der neuen Musik dar, nicht die Propagandaschrift gleichen Namens.
Was können wir von den Vorlesungen lernen? Als Erstes dies: Adorno kommt nach Darmstadt als Schüler Alban Bergs, der sich berufen fühlt, die jungen Leute zu lehren, worauf es im Komponieren eigentlich ankommt. Dass dieses Selbstbild auf einer Verkennung des eigenen symbolischen Ortes beruht, versteht sich. Adorno, das zeigt die beigelegte CD durchgehend, ist zwar enthusiastisch bei der Sache und wechselt, wo immer es nottut, wie ein "richtiger Musiker" lässig in die praktische Demonstration am Klavier und in das Singen über. Dennoch haben ihn Boulez, Stockhausen und später auch Ligeti stets artig mit "Herr Professor" angeredet, was doch wohl signalisierte, dass sie ihn, der in Kompositionskursen auch eigene Werke besprach, durchaus nicht als Autorität für die eigene Produktion wahrnehmen wollten und konnten.
Natürlich war Adorno seinem seriellen Publikum haushoch überlegen, wenn es um Fragen zu Technik und Wissenschaft ging oder um den theoretischen Widersinn einer Vision von der Szientifizierung alles Künstlerischen. Auch empfand er die geschichtslose Aura des Neubeginns, die seinerzeit nicht bloß in Darmstadt grassierte, mit Grund als unheimlich, ob sie sich nun in der naiven Begeisterung über moderne Technik oder im Gestus "Schönberg est mort" kundtat. Aber die Rationalität des Theoretikers ist nicht die des Komponisten und die stimmige Kritik von Begriffen, mit denen sich Künstler über ihre Lage verständigen, etwas anderes als eine phänomengerechte Bewertung ihrer Werke.
Die frühen "punktuellen" Kompositionen von Stockhausen, Goeyvaerts und anderen empfand Adorno jedoch nicht zuletzt darum als Figuren ohne Sinn, als Formen zelebrierter Leere, weil er sie immer schon vor dem Hintergrund der Ahistorizität serieller Parolen beurteilte. Leitend blieb für ihn der Entwicklungsgedanke der deutschen Tradition (Haydn, Beethoven, Brahms), der Klänge motivisch ineinander überleitete und ihre festen wie variablen Bestimmungen als Momente eines Fortgangs konstruierte.
Musikalische Zeit sollte eine subjektive Geschichte sein, eine zwar, die in Fragmente zerbirst und deren Dynamik der Atem stockt, aber eine Geschichte gleichwohl. Ein Nacheinander, in dem jedes Ereignis für sich selbst steht, war für Adorno im Grunde fröhlicher Positivismus, ein technifizierter Kotau vor der Destruktion musikalischer Erinnerungsfähigkeit, die bei Schönberg noch als Leiden an einer Katastrophe zum Ausdruck gekommen sei. Dass sich musikalische Zeit legitim auch als Medium der Exposition von Ereignissen verstehen lässt, die ihrem Sinn nach simultan sind wie Farben und Flecke eines Bildes, hat Adorno seltsamerweise stets bestritten und so wortreich wie inkonsistent auf den Effekt einer ideologischen Struktur heruntergebrochen.
Unabhängig davon bleibt seine historische Leistung, den kulturkonservativen Einschlag in seiner Kritik des Serialismus zunehmend so zu modifizieren, dass am Ende eine profilierte Korrektur der eigenen Ausgangsposition dastand. Adorno erkannte, dass das motivisch-thematische Denken nicht länger das Maß des Komponierens sein konnte und die Vorstellung musikalischer Zeit sich vom Modell eines sprachähnlich organisierten Kontinuums vielleicht lösen musste. Ein Text wie "Vers une musique informelle" ist Plädoyer für eine musikalische Morphologie, die das serielle Prinzip integriert, aber keine Verklärung der "freien Atonalität" mehr. Hier hat Adorno, das gilt es in aller Deutlichkeit festzuhalten, mehr von den "jungen Komponisten" gelernt als sie von ihm. Darin liegt auch das Aufregende der Vorlesungen: zu erleben, wie er immer ernster mit sich ins Gericht geht und die eigenen Argumente wie die der anderen analytisch prüft. Am Ende ist aus dem leicht anachronistischen Repräsentanten der Wiener Schule der Philosoph hervorgetreten, der über intime kompositorische Erfahrungen verfügt, ohne sie blank zum Kriterium philosophischer Kritik zu erheben. In dieser Position läuft Adorno zu der Stärke auf, in der er keine Konkurrenz zu fürchten braucht.
Trotzdem bleiben gravierende Probleme. Einerseits ist das Niveau, mit dem Adorno über Probleme der Neuen Musik spricht, beispiellos und ein Jungbrunnen des Geistes, angesichts dessen man melancholisch werden könnte. Verlaufen Diskussionen über Neue Musik gegenwärtig doch oft genug so, dass relevante Konflikte gar nicht erst auf die Tagesordnung kommen. Andererseits wäre Adorno gerade hier der Letzte, der helfen könnte. Seine Kritik der "Kulturindustrie" behält in vielem ihre Gültigkeit, aber sein Umgang mit Musikgeschichte bleibt dezisionistisch und von wüsten Vorurteilen geprägt. Das Engagement für Schönberg ist unterm Strich mehr Musikpolitik als Musikphilosophie. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte das seinen guten Sinn. Es ist Adornos untilgbares Verdienst, die Musik der Wiener Schule in Deutschland zusammen mit anderen beheimatet zu haben. Nur wurde die Konstruktion Schönberg vs. Strawinsky damit nicht auch philosophisch richtig.
Die Vorlesungen zeigen, dass die schmale Materialbasis der Adornoschen Theorie auch einen rationalen Pluralismus nur in sehr engen Grenzen zulässt. Sie reklamieren den "Stand" des Komponierens, aber Edgard Varèse, Olivier Messiaen, Luigi Nono und Bernd Alois Zimmermann kommen nicht vor. Im Text finden sich Ausfälle gegen Strawinsky, Hindemith, Dilthey und andere, denen förmlich eingestanzt ist, dass sie über ungelöste eigene Probleme hinwegreden. Wie kann man die Einfühlungslehre von Dilthey argumentfrei der Lächerlichkeit preisgeben, aber die eigene "objektive" Kritik an Hindemith kurz darauf damit begründen, dass man dem Komponisten einmal sehr nahe gestanden habe? Wenn Idiosynkrasie und die Berufung auf Wahrheit derart in eins fallen, begeht Theorie Harakiri. Die Kehrseite des Genies ist der Dilettant.
Befremdlich bleibt auch die fast völlige Abwesenheit politischer Historie. Die Frage muss erlaubt sein: Wie kann man Gedichten "nach Auschwitz" die Legitimität absprechen, aber über die Darmstädter avantgardistische Variante des Mythos der Stunde null, die hinter jenem von Neubayreuth nicht zurückstand, den Mantel des Schweigens ausbreiten? Allzumal die Geschichtsferne des seriellen Diskurses Adorno seiner eigenen Aussage zufolge doch so verstört hat. Aber mehr als die vage Unterstellung, der Serialismus antizipiere die "verwaltete Welt", kam da nicht. Was der kritische Theoretiker an der "Jugendmusikbewegung" mit Fug und Recht als "Verdrängung der Vergangenheit" geißelte, war gegenüber den Kranichsteiner Genossen tabu. "Auschwitz" assoziierte Adorno allein beim "Sacre du Printemps".
RICHARD KLEIN
Theodor W. Adorno: "Kranichsteiner Vorlesungen". Herausgegeben von Klaus Reichert und Michael Schwarz. Suhrkamp Verlag, Berlin 2014. 600 S., geb., 59,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
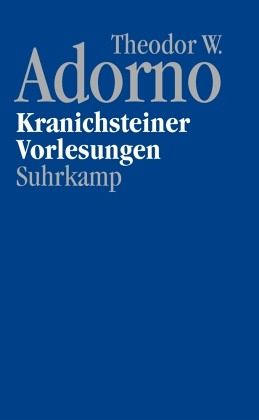





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.05.2014
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.05.2014