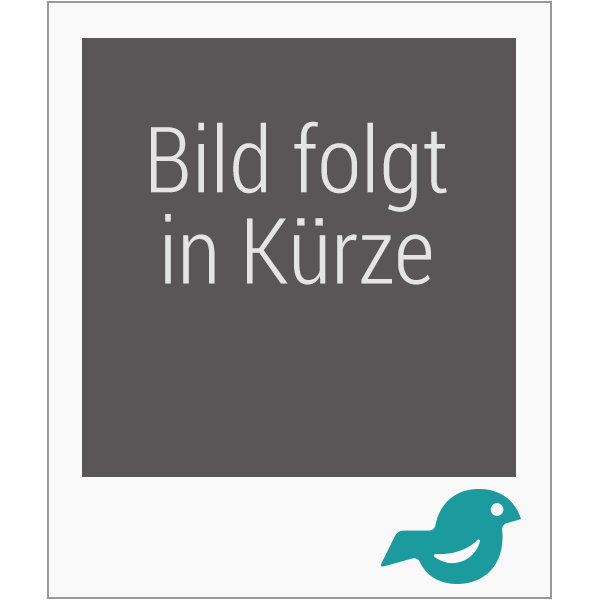
Korruption in Deutschland. Portrait einer Wachstumsbranche.
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar




Britta Bannenberg ist Professorin für Kriminologie, Strafverfahrensrecht und Strafrecht an der Universität Bielefeld. Wolfgang Schaupensteiner ist Oberstaatsanwalt in Frankfurt am Main.
Produktdetails
- Verlag: C.H.Beck
- ISBN-13: 9783406510663
- ISBN-10: 3406510663
- Artikelnr.: 12512215
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.04.2004
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.04.2004Balanceakte sind für ihn Routine
Wolfgang Schaupensteiner, der Korruptionsspezialist, führt die Ermittlungen gegen Bundesbank-Präsident Welteke
An einem solchen Tag erreicht Wolfgang Schaupensteiner die volle Drehzahl binnen weniger Minuten. Während der Oberstaatsanwalt am Montag morgen selbst die Anklage gegen einen ehemaligen Mitarbeiter im Frankfurter Hochbauamt vertrat, haben viele Medienvertreter verzweifelt und vergeblich seine Nummer gewählt. Sie alle wollten wissen, wie die Causa Welteke ausgehen könnte. Deutschlands bekanntester Ermittler im Korruptionsfach konnte, wollte und durfte dazu aber nichts sagen, weil, wenn überhaupt einer, er für den Bundesbankpräsidenten zuständig ist. Der Dienstsitz Frankfurt
Wolfgang Schaupensteiner, der Korruptionsspezialist, führt die Ermittlungen gegen Bundesbank-Präsident Welteke
An einem solchen Tag erreicht Wolfgang Schaupensteiner die volle Drehzahl binnen weniger Minuten. Während der Oberstaatsanwalt am Montag morgen selbst die Anklage gegen einen ehemaligen Mitarbeiter im Frankfurter Hochbauamt vertrat, haben viele Medienvertreter verzweifelt und vergeblich seine Nummer gewählt. Sie alle wollten wissen, wie die Causa Welteke ausgehen könnte. Deutschlands bekanntester Ermittler im Korruptionsfach konnte, wollte und durfte dazu aber nichts sagen, weil, wenn überhaupt einer, er für den Bundesbankpräsidenten zuständig ist. Der Dienstsitz Frankfurt
Mehr anzeigen
des Bundesbankchefs gibt den Ausschlag, nicht Berlin als Schauplatz der Euro-Familien-Suite-Affäre im Hotel Adlon.
Viele Staatsanwälte wären gewiß unglücklich über diese Fügung gewesen, die bestenfalls den Balanceakt auf den rotierenden Mühlsteinen von Politik und Wirtschaft verheißt. Wolfgang Schaupensteiner klang an diesem Montagnachmittag nicht gerade so, als leide er bei dem Gedanken. Seit gestern, da die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Welteke wegen des Anfangsverdachts der Vorteilsnahme bejahte, liegt die Akte auf seinem Tisch. Das Ende aller Spekulationen. Jetzt beginnt die Routine.
Manche unterstellen dem Fünfundfünfzigjährigen Züge von Arroganz. Einer, der wie er bei "Sabine Christiansen" mit scheinbar lässigem Gestus Stammgäste des Politbetriebs an seinen Argumenten abprallen läßt, wird solche Attribute kaum vermeiden können. Schaupensteiners sonore Stimme, elegante Erscheinung, das inzwischen ergraute, volle Haar und ein scharfer Intellekt tun ihr übriges. Hinter der ungewollten Attitüde, die der Bildschirm noch verstärkt, verbirgt sich indes das über die Jahre gehärtete Selbstbewußtsein eines - das bestätigen auch seine Kritiker - enorm fleißigen und gewissenhaften Juristen.
1987 geriet er eher zufällig auf ein Gebiet, das er, weil zu banal und undifferenziert, schon längst nicht mehr "Sumpf" zu nennen pflegt. Im Buch "Korruption in Deutschland, Porträt einer Wachstumsbranche", das vor zwei Wochen erschienen ist, beschreibt Schaupensteiner, der als Anwalt begann und nach seinem Wechsel in den Staatsdienst eigentlich Handelsrichter werden wollte, sein Schlüsselerlebnis. In einer der Akten, in die sich der junge Assessor auf der vermeintlichen Durchgangsstation Staatsanwaltschaft einarbeitete, fand er einen Vermerk. Die Notiz deutete an, daß ein Beamter der Stadt von einem Bauunternehmer bezahlt worden sei. Schaupensteiner, der im Elternhaus, wie er in einem früheren Interview einmal sagte, preußische Tugenden vermittelt bekam, war damals seiner Erinnerung nach "total konsterniert" bei der Vorstellung, daß es Bestechlichkeit in der öffentlichen Verwaltung überhaupt geben könne. Sein Eifer, der ihm erhalten geblieben ist, richtete sich darauf, diesen Verdacht zu klären. Seitdem sind in seinem Dezernat Hunderte Fälle dazugekommen mit Legionen von Beschuldigten.
Das Buch, das der Oberstaatsanwalt gemeinsam mit der Bielefelder Kriminologin Britta Bannenberg verfaßt hat, richtet sich weniger an das Fachpublikum denn "an alle Interessierten". Dazu zählt Schaupensteiner vor allem auch die Vorgesetzten derer, die Aufträge verteilen oder empfangen. Durch Beispiele und Analyse soll Verständnis dafür vermittelt werden, wie Korruption funktioniert. Das Buch ist aber auch der Versuch, das Exemplarische dieses Zweiges der Schattenwirtschaft, der nach Schätzungen der Autoren allein in der öffentlichen Bauverwaltung einen jährlichen Schaden von fünf Milliarden Euro anrichtet, anhand der Frankfurter Affären herauszuarbeiten.
Wie falsch indes der in anderen Regionen gerne gepflegte Eindruck war, Schmiergeldbeziehungen dieser Art und Dimension seien für die Verhältnisse und die Begehrlichkeiten in der Finanzmetropole typisch und daher nicht auf die Republik übertragbar, hat sich nicht nur in den vergangenen Jahren gezeigt. Affären wie um den Bau des neuen Fußballstadions in München offenbaren vielmehr aufs neue, daß die Mär von der einmaligen Bakschisch-Folklore am Main eine Notlüge derer war, die vor den Mühen zurückschreckten, das eigene Umfeld zu beackern. Gleichwohl ist die Frankfurter Welle, die in den neunziger Jahren vom Straßenbau- bis ins Friedhofsamt schwappte, für Forschungen dieses Phänomens etwas Besonderes geblieben. An den Erosionen läßt sich nämlich nachzeichnen, wie das Streben nach mehr die Scheu vor der Entdeckung überlagert. Im Frankfurter Hochbauamt gibt es mittlerweile die dritte Auflage einer Korruptionsaffäre.
Nicht also die skandalisierten Einzelfälle, wie Wildmoser oder Müllverbrennung in Köln, sind in der Sicht des Mannes, der 1993 die Leitung der ersten Korruptionsabteilung bei einer deutschen Staatsanwaltschaft übernahm, die symptomatischen. Seine Überzeugung, daß "Frankfurt überall" sei, ist ebenso fundiert wie die Sorge, Korruption beginne in Deutschland Alltag zu werden - sowohl in den Behörden als auch in der Privatwirtschaft.
Den Quereinstieg in die Politik, die von seinen Kenntnissen bei mancher Gesetzesnovelle profitiert hat, kann sich Wolfgang Schaupensteiner dennoch nicht vorstellen. Dort, wo er ist, da könne er wesentlich mehr bewirken.
HELMUT SCHWAN
Britta Bannenberg/Wolfgang J. Schaupensteiner, Korruption in Deutschland, Verlag C. H. Beck, 14,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Viele Staatsanwälte wären gewiß unglücklich über diese Fügung gewesen, die bestenfalls den Balanceakt auf den rotierenden Mühlsteinen von Politik und Wirtschaft verheißt. Wolfgang Schaupensteiner klang an diesem Montagnachmittag nicht gerade so, als leide er bei dem Gedanken. Seit gestern, da die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Welteke wegen des Anfangsverdachts der Vorteilsnahme bejahte, liegt die Akte auf seinem Tisch. Das Ende aller Spekulationen. Jetzt beginnt die Routine.
Manche unterstellen dem Fünfundfünfzigjährigen Züge von Arroganz. Einer, der wie er bei "Sabine Christiansen" mit scheinbar lässigem Gestus Stammgäste des Politbetriebs an seinen Argumenten abprallen läßt, wird solche Attribute kaum vermeiden können. Schaupensteiners sonore Stimme, elegante Erscheinung, das inzwischen ergraute, volle Haar und ein scharfer Intellekt tun ihr übriges. Hinter der ungewollten Attitüde, die der Bildschirm noch verstärkt, verbirgt sich indes das über die Jahre gehärtete Selbstbewußtsein eines - das bestätigen auch seine Kritiker - enorm fleißigen und gewissenhaften Juristen.
1987 geriet er eher zufällig auf ein Gebiet, das er, weil zu banal und undifferenziert, schon längst nicht mehr "Sumpf" zu nennen pflegt. Im Buch "Korruption in Deutschland, Porträt einer Wachstumsbranche", das vor zwei Wochen erschienen ist, beschreibt Schaupensteiner, der als Anwalt begann und nach seinem Wechsel in den Staatsdienst eigentlich Handelsrichter werden wollte, sein Schlüsselerlebnis. In einer der Akten, in die sich der junge Assessor auf der vermeintlichen Durchgangsstation Staatsanwaltschaft einarbeitete, fand er einen Vermerk. Die Notiz deutete an, daß ein Beamter der Stadt von einem Bauunternehmer bezahlt worden sei. Schaupensteiner, der im Elternhaus, wie er in einem früheren Interview einmal sagte, preußische Tugenden vermittelt bekam, war damals seiner Erinnerung nach "total konsterniert" bei der Vorstellung, daß es Bestechlichkeit in der öffentlichen Verwaltung überhaupt geben könne. Sein Eifer, der ihm erhalten geblieben ist, richtete sich darauf, diesen Verdacht zu klären. Seitdem sind in seinem Dezernat Hunderte Fälle dazugekommen mit Legionen von Beschuldigten.
Das Buch, das der Oberstaatsanwalt gemeinsam mit der Bielefelder Kriminologin Britta Bannenberg verfaßt hat, richtet sich weniger an das Fachpublikum denn "an alle Interessierten". Dazu zählt Schaupensteiner vor allem auch die Vorgesetzten derer, die Aufträge verteilen oder empfangen. Durch Beispiele und Analyse soll Verständnis dafür vermittelt werden, wie Korruption funktioniert. Das Buch ist aber auch der Versuch, das Exemplarische dieses Zweiges der Schattenwirtschaft, der nach Schätzungen der Autoren allein in der öffentlichen Bauverwaltung einen jährlichen Schaden von fünf Milliarden Euro anrichtet, anhand der Frankfurter Affären herauszuarbeiten.
Wie falsch indes der in anderen Regionen gerne gepflegte Eindruck war, Schmiergeldbeziehungen dieser Art und Dimension seien für die Verhältnisse und die Begehrlichkeiten in der Finanzmetropole typisch und daher nicht auf die Republik übertragbar, hat sich nicht nur in den vergangenen Jahren gezeigt. Affären wie um den Bau des neuen Fußballstadions in München offenbaren vielmehr aufs neue, daß die Mär von der einmaligen Bakschisch-Folklore am Main eine Notlüge derer war, die vor den Mühen zurückschreckten, das eigene Umfeld zu beackern. Gleichwohl ist die Frankfurter Welle, die in den neunziger Jahren vom Straßenbau- bis ins Friedhofsamt schwappte, für Forschungen dieses Phänomens etwas Besonderes geblieben. An den Erosionen läßt sich nämlich nachzeichnen, wie das Streben nach mehr die Scheu vor der Entdeckung überlagert. Im Frankfurter Hochbauamt gibt es mittlerweile die dritte Auflage einer Korruptionsaffäre.
Nicht also die skandalisierten Einzelfälle, wie Wildmoser oder Müllverbrennung in Köln, sind in der Sicht des Mannes, der 1993 die Leitung der ersten Korruptionsabteilung bei einer deutschen Staatsanwaltschaft übernahm, die symptomatischen. Seine Überzeugung, daß "Frankfurt überall" sei, ist ebenso fundiert wie die Sorge, Korruption beginne in Deutschland Alltag zu werden - sowohl in den Behörden als auch in der Privatwirtschaft.
Den Quereinstieg in die Politik, die von seinen Kenntnissen bei mancher Gesetzesnovelle profitiert hat, kann sich Wolfgang Schaupensteiner dennoch nicht vorstellen. Dort, wo er ist, da könne er wesentlich mehr bewirken.
HELMUT SCHWAN
Britta Bannenberg/Wolfgang J. Schaupensteiner, Korruption in Deutschland, Verlag C. H. Beck, 14,90 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben


