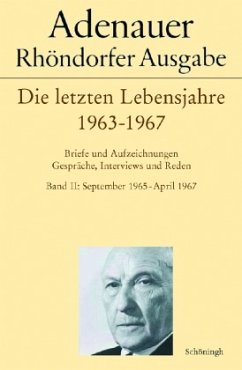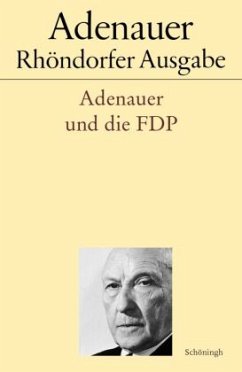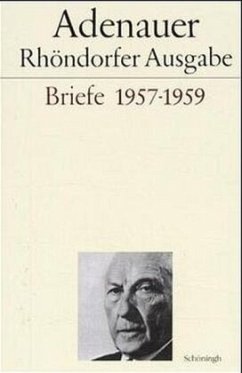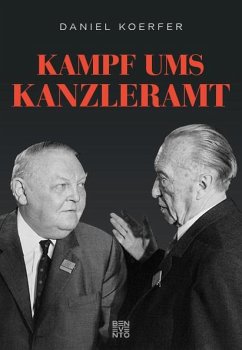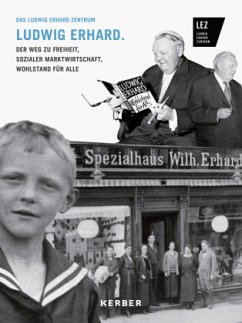allem Interessengruppen wie Gewerkschaften und Industrieverbände immer wieder auf, ihre Ansprüche in Grenzen zu halten, um die Leistungsfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft nicht zu überfordern und keine inflationären Tendenzen heraufzubeschwören.
Der Quellenband verdeutlicht, welches normative Grundverständnis den Maßhalteappellen des Ministers zugrunde lag. So glaubte Erhard offensichtlich daran, nicht nur den Einzelnen, sondern auch Interessengruppen durch moralische Überzeugungsarbeit beeinflussen zu können. Sein grundsätzlich optimistisches Menschenbild brachte ihn dazu, "Moral Suasion" als Instrument der Wirtschaftspolitik einzusetzen. So äußerte er sich im Januar 1956 gegenüber dem Bundeskanzler: "Bisher habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass ein starker und entschlossener Wille und eine moralische Haltung, die um das Ganze weiß, gegenüber einer egoistischen Politik zuletzt obsiegt."
Diese Grundeinstellung brachte ihn jedoch regelmäßig in Konflikte mit Adenauer, der - auch bedingt durch seine Erfahrungen in der Weimarer Republik und der NS-Zeit - ein zutiefst pessimistisches Menschenbild vertrat. Adenauer misstraute allen Versuchen, Menschen oder gar organisierte Gruppen durch Überzeugungsarbeit zu bessern. Stattdessen sah er die Notwendigkeit, menschlichen Egoismus zu akzeptieren und - im Idealfall - politisch zu instrumentalisieren. So betrachtete er eine expansive Konjunkturpolitik als wichtiges Wahlkampfinstrument und witterte Gefahr, wenn sein Wirtschaftsminister im Vorfeld von Wahlen zum Maßhalten aufrief. Auch ergab es aus seiner Sicht keinen Sinn, frisch geweckte Konsumwünsche durch Maßhalteappelle wieder zu drosseln: "Jetzt plötzliche Zurückhaltung und Enthaltsamkeit zu predigen, halte ich für völlig aussichtslos."
Auch Adenauer propagierte jedoch keineswegs unbegrenztes Konsumdenken. Vielmehr vertrat auch er eine Idee des "rechten Maßes", die nicht zuletzt durch seine Kontakte zur katholischen Soziallehre bestimmt war. Ein solches "Maßhalten" äußerte sich jedoch gerade nicht in Form von Appellen an einzelne Akteure, sondern vielmehr als grundsätzliche Relativierung ökonomischer Ziele im Vergleich zu anderen Politikfeldern. So betrachtete er die Wirtschaftspolitik als Teil einer umfassenden Gesellschaftspolitik, bei der es nicht ausschließlich um die Steigerung des Sozialproduktes ging. Gerade weil Menschen in Marktprozessen unabdingbar egoistisch handelten, sollte der Markt aus Adenauers Sicht nicht alles regeln.
Daher hatte Adenauer im Gegensatz zu Erhard keine Probleme damit, insbesondere im Bereich der Daseinsfürsorge marktwirtschaftliche Instrumente gegenüber anderen Ansätzen zurückzustellen. Ein Beispiel dafür war die Dynamisierung der Renten ("Schreiber-Plan") im Jahr 1957 mit Hilfe der SPD, bei der Adenauer die Warnungen seines Wirtschaftsministers vor einer "falschen Sozial-Romantik" ignorierte.
Doch zurück zum Quellenband der "Rhöndorfer Ausgabe": Hier zeigt sich eindrucksvoll, wie Erhard mit seiner moralischen Überzeugungsarbeit bereits in den fünfziger Jahren ins Hintertreffen geriet. Nicht nur Adenauer, sondern auch breite Teile der Öffentlichkeit brachten seinen Appellen an die Eigenverantwortung von Interessengruppen kein Verständnis entgegen. So kann es nicht verwundern, dass Erhard später als Bundeskanzler mit seinem Entwurf einer "Formierten Gesellschaft" (1965) noch größeres Unverständnis erntete, was letztlich zu seinem Scheitern beitrug. Seine Vorstellung, Gewerkschaften, Unternehmensverbände und Lobbygruppen würden eigenverantwortlich auf die Begehrlichkeiten ihrer Mitglieder einwirken, passte offensichtlich nicht zur bundesdeutschen Realität. Hier zeigt sich nicht zuletzt die Tragik eines Politikers, der die Verantwortungsbereitschaft von Bürgern, Unternehmen und Verbandsvertretern überschätzt hatte.
Der Band liefert somit nicht nur wertvolle Einblicke in die Genese der Sozialen Marktwirtschaft, sondern verdeutlicht zugleich grundlegende ethische Dilemmata der Wirtschaftspolitik: So führt wirtschaftlicher Erfolg eher zu einer Ausweitung von Ansprüchen als zu saturierter Mäßigung, und Eigenverantwortung erweist sich zumeist als knappe Ressource. Daher gerät Ordnungspolitik, die Eigeninitiative ermöglicht und Anreize zur Schaffung von Wohlstand setzt, regelmäßig in einen Konflikt mit anderen sozial- und gesellschaftspolitischen Zielen, der zumeist nur situativ entschärft, aber kaum endgültig gelöst werden kann. Aus diesem Grund wird die Zukunftsfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft nicht zuletzt davon abhängen, dass es - wie von Müller-Armack mit dem Begriff der "irenischen Formel" angedeutet - gelingt, unterschiedliche Interpretationen des "rechten Maßes" immer wieder neu zu versöhnen.
CHRISTIAN HECKER
Dominik Geppert / Hans-Peter Schwarz (Hrsg.): Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und die Soziale Marktwirtschaft, Rhöndorfer Ausgabe, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn et al. 2019, 1216 Seiten, 129 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Allgemeine Zeitung