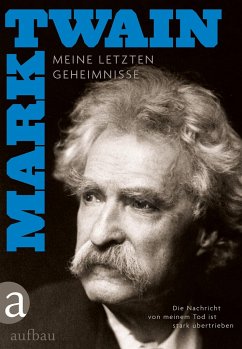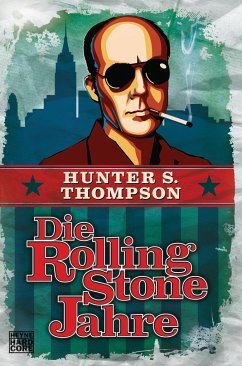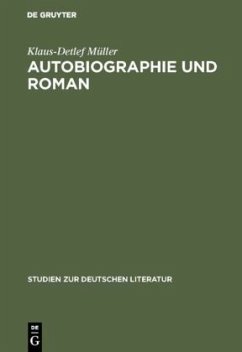wieder mit dir sprechen!" Auslöser ihrer Wut war ein Artikel, der ihre Ähnlichkeit mit den Eltern des Romanhelden suggerierte. Die Szene findet sich in Shteyngarts bewegender Autobiographie "Kleiner Versager", in der er zwischen Schmerz und Scherz erzählt, wie er in Leningrad und New York aufwuchs. Das Buch hat er wieder seinen Eltern gewidmet - und seinem Psychoanalytiker.
"Handbuch für den russischen Debütanten" und "Snack Daddys abenteuerliche Reise" (2006) sind schwarzhumorige Schelmengeschichten über amerikanisch sozialisierte Taugenichtse im postkommunistischen Osten, wo sie in fiktiven Ländern in die Wirren der neuen Wirtschafts- und Weltordnung geraten. Und in der Dystopie "Super Sad True Love Story" (2010) karikiert Shteyngart ein gescheitertes Amerika, das vor der Übernahme durch ausländische Staatsfonds steht. Die "New York Times" erklärte den reisefreudigen Romancier zum lustigsten Vertreter der zeitgenössischen Einwandererliteratur.
Shteyngart, 1972 in Leningrad geboren, hieß ursprünglich Igor mit Vornamen. Erst als seine Eltern mit ihm 1979 in die Vereinigten Staaten eingewandert waren, wurde er zu Gary, denn Igor "heißt Frankensteins Gehilfe, und ich habe weiß Gott schon genug Probleme". Auch der Name seiner Familie war früher ein anderer, bis wohl ein sowjetisches Missgeschick aus den Steinhorns die Shteyngarts machte. Als Igor Steinhorn wäre der Autor also "in Wahrheit zum bayerischen Pornostar bestimmt" gewesen.
Einer der vielen Namen, die Shteyngart im Laufe der Jahre haben wird, gibt seinem Buch den Titel. In einer Mischung aus Englisch, Russisch und Bedauern über die Berufswahl des Sohns bezeichnete seine Mutter ihn als "failurtschka", als "kleinen Versager". Dagegen hatte sie ihn als Kind "solnyschko" genannt, ihren "kleinen Sonnenschein", während sein Vater enttäuscht "Rotznase" zu ihm sagte, weil Igor ein kränklicher, asthmageplagter Junge war. Der Versuch, das schwierige Verhältnis zu den Eltern zu verstehen, durchzieht "Kleiner Versager".
Zu Shteyngarts liebsten Kindheitserinnerungen gehört das Versteckspielen mit dem Vater am Moskauer Platz in Leningrad, auch wenn er davon wieder krank wurde, was die Mutter ihrem Mann zum Vorwurf machte. Dann flogen zwischen den Eltern die derben Flüche hin und her. Neben dem Verstecken liebte Igor die russische Sprache. Für seine Großmutter schrieb er mit fünf Jahren das Buch "Lenin und seine magische Gans". Sie zahlte ein Käsestück pro Seite.
Die Shteyngarts waren unter den sowjetischen Juden, denen im Gegenzug für amerikanische Weizenlieferungen ihre Ausreise ermöglicht wurde. Über Ost-Berlin, Wien und Rom, wo sie russische Kompasse mit Hammer und Sichel an kommunistische Italiener verkauften, kamen sie nach New York. Dort hieß Igor nun Gary und ging auf eine jüdische Schule, war aber mit seinem Pelzmantel und den Selbstgesprächen auf Russisch ein Außenseiter. Als er in seinem fehlerhaften Englisch den Weltraumroman "Die Prüfunk" verfasst hatte, sollte er ihn vor der Klasse lesen. Seine englische Stimme klang seltsam für ihn, doch die anderen Kinder hörten zu, gespannt, wie es weiterging. Ein "verhasster Freak" lenkte so ihre Aufmerksamkeit "von meinem Russischsein auf mein Geschichtenerzählen".
Die derben russischen Flüche begleiteten die Ehe der Eltern auch in Amerika. Wenn sie nicht mehr miteinander redeten, fiel Gary die Rolle des Vermittlers zu. Die Mutter strafte nicht nur ihren Mann, sondern auch Gary mit ihrem Schweigen. Sein Vater schlug ihn. Das Angstwort seiner Kindheit und Jugend lautete dennoch "raswod", Scheidung, und trotz aller Streitereien wollte er seine Eltern unbedingt zusammenhalten, weil "wir die Familie Shteyngart sind, mit nur drei Familienmitgliedern - zu wenig, um uns zu entzweien".
Während der Highschoolzeit war Gary meistens betrunken und bekifft, und er erwies sich als grottenschlechter Schüler. Auf dem liberalen Oberlin College in Ohio trank und kiffte er auch (das Ausmaß seiner Exzesse brachte ihm einen neuen Namen ein: Gruselgary), allerdings war er plötzlich ein Einserkandidat. Wie in einem satirischen Campusroman schildert Shteyngart, dass Idealismus in Anspruchslosigkeit umschlägt, wenn "Studenten, Leute aus der Kleinstadt und andere auserlesene Versager" die Lehre übernehmen. In dieser Welt der veganen Wohn- und Speisekooperativen hegte Gary insgeheim Sympathie für den "Schinkenbomber", der die Hummus- und Erdnussbuttervorräte sabotierte.
Wenn Shteyngart den Ich-als-Jargon des Collegemilieus aufspießt - "Ich als Frau finde ..." -, nimmt er sich andererseits nicht von dieser Sprechweise aus, ganz im Gegenteil. Am College schrieb er nämlich wieder, nur versuchte er jetzt nicht mehr, sich wie in der Schule von allem Russischen wegzuschreiben; vielmehr ging es ihm gerade darum, "eine Geschichte zu haben, eine Vergangenheit". Mit anderen Worten: Er lernte, "Ich als Einwanderer ..." zu sagen. Seine drei Romane haben männliche Hauptfiguren mit einer russisch-jüdischen Familiengeschichte. Bei deren Wiederlektüre war er "entsetzt, wie sehr sich Fakten und Fiktion überschnitten, wie freizügig ich mit den wahren Begebenheiten aus meinem Leben umgegangen war, als wäre es ein Ausverkauf - alles über mich muss raus!"
Es ist natürlich nicht alles gesagt, weder in Shteyngarts Büchern noch in seinem Leben. Der Titel des vorletzten Kapitels der Autobiographie greift sein Angstwort "raswod" noch einmal auf. Statt der gefürchteten Scheidung der Eltern meint es die zwischen Eltern und Kind. Aber das letzte Kapitel handelt von einem Besuch in Sankt Petersburg (wie Leningrad mittlerweile wieder heißt), bei dem Shteyngart und seine Eltern mehr als dreißig Jahre nach ihrer Ausreise zum ersten Mal wieder gemeinsam in ihrer alten Heimatstadt waren. Shteyngart fiel auf, dass der Vater ihn nicht mehr "kleiner Sohn" nannte. "Jetzt bin ich einfach sein Sohn. Jetzt bin ich mit ihm auf gleicher Augenhöhe, und unsere Beziehung ist klar."
THORSTEN GRÄBE
Gary Shteyngart:
"Kleiner Versager".
Aus dem Englischen von Mayela Gerhardt. Rowohlt Verlag, Reinbek 2015.
474 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.10.2015
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.10.2015