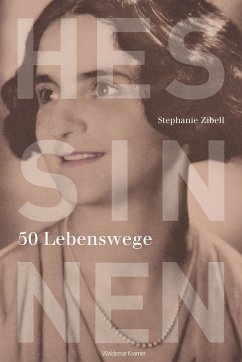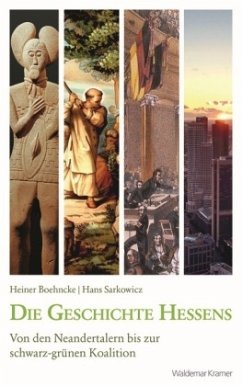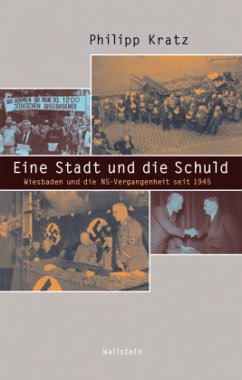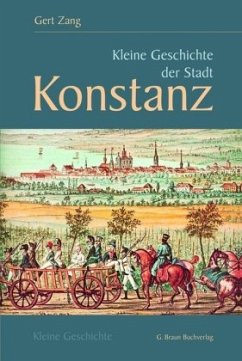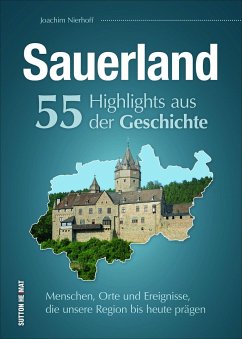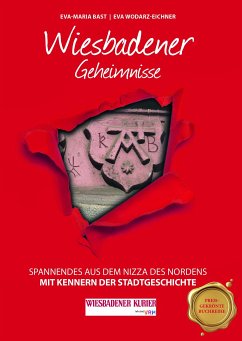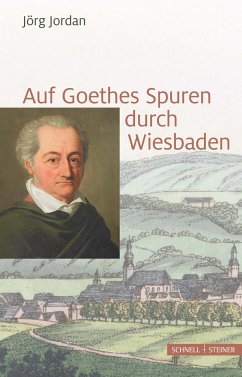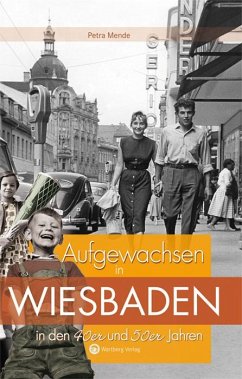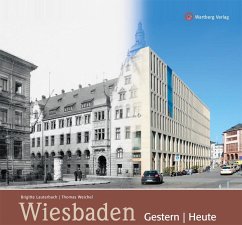Bad" handelte. Die zweite Version hält Susanne Kronenberg für plausibler. Sie ergänzt, dass es noch ein zweites Wisibada gibt: einen Asteroiden, der 1911 vom Astronomen Franz Kaiser entdeckt und nach dessen Geburtsort Wiesbaden benannt wurde.
Auch Kronenbergs Buch enthält viele historische Fakten. Aber es kommt flotter daher. Auf dem Buchdeckel werden "100 Gründe, stolz auf diese Stadt zu sein", angekündigt. Und 100 kurzweilige Seiten reichen der Autorin, die auch Krimis schreibt, um ihr Versprechen einzulösen. Dass Goethe und seine Aufenthalte im Biebricher Schloss erwähnt werden, verwundert nicht. Aber auch der irische Schriftsteller James Joyce wohnte gelegentlich in Wiesbaden - als Patient einer Augenheilanstalt von Weltruf. Alexander Pagenstecher gründete sie 1856. Er warb bei begüterten Patienten größere Spenden ein und stellte mit dem Geld zwei Assistenzärzte ein, die sich um die Augenleiden mittelloser Wiesbadener kümmerten.
Kronenberg erzählt, dass Alexander Pagenstechers Sohn Hermann die Erfolgsgeschichte der Klinik fortsetzte. Aber nicht alle kamen. Königin Viktoria von England, die prominenteste Patientin, ließ sich von Pagenstecher in London behandeln. 1982 ging sein Lebenswerk in den Horst-Schmidt-Kliniken auf. Doch das "Fachinstitut für künstliche Augen" an der Taunusstraße erinnert noch heute an die Familie Pagenstecher. Jede Prothese ist ein von Hand bemaltes Unikat.
Dass Wiesbaden mit dem "Caligari" ein besonders schönes Kino besitzt, ist nicht zu übersehen. Die Stadt ist außerdem Sitz der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, das nationale Filmerbe zu bewahren und öffentlich zu zeigen.
Aber Wiesbaden war auch Sitz des ZDF. Doch das Quartier "Unter den Eichen" im Nordwesten der Innenstadt wurde schon nach ein paar Jahren zu klein. Schrittweise ging der Umzug nach Mainz vonstatten, bis 1984 das Sendezentrum am Lerchenberg fertig war.
Mehr Glück hatte die Stadt mit dem Bundeskriminalamt und dem Statistischen Bundesamt. Über deren Geschichte erfährt man in Minks Buch einiges. Sie schreibt etwa, dass der Speisesaal der Statistiker Platz für 550 Personen biete, aber die entscheidende Frage, warum die beiden Bundesbehörden nach Wiesbaden kamen, bleibt offen.
Dafür wird präzise beschrieben, warum der russische Schriftsteller und Dichter Fjodor Dostojewski die Stadt so gern besuchte: wegen der Spielbank. Er verlor dort seine gesamte Reisekasse, so dass er, um rasch wieder zu Geld zu kommen, innerhalb von 26 Tagen den Klassiker "Der Spieler" schreiben musste.
Sowohl Mink als auch Kronenberg stellen den Kochbrunnen vor. Aber wer sich auf hohem Niveau mit dem Sinnbild der römischen Bäderkultur auseinandersetzen will, muss zu dem ebenfalls gerade erschienenen großformatigen und reich bebilderten Buch von Bernd-Michael Neese greifen.
Der promovierte Historiker stellt die mächtigste unter den heißen Quellen der früheren Weltkurstadt in seinem historischen Umfeld vor und schreibt dazu: "Der Kochbrunnenplatz in seiner heutigen Gestaltung lässt freilich von seinem einstigen Glanz nichts mehr erahnen."
EWALD HETRODT
Marion Mink: Kleine Geschichte der Stadt Wiesbaden. Karlsruhe 2016. 184 Seiten. 19,90 Euro.
Susanne Kronenberg: Wiesbaden - einfach spitze. 2016. Gudensberg-Gleichen. 103 Seiten. 14,90 Euro
Bernd-Michael Neese. Der Kochbrunnen - Von 1800 bis zur Gegenwart. Wiesbaden 2016. 108 Seiten. 18,90 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung
Frankfurter Allgemeine Zeitung