von deren Herkunft aus dem Evangelium bestimmt - ein Bild, das wiederum zu erklären beansprucht, wann und warum diese Kirche ihrer Herkunft untreu zu werden drohte, wann und warum sie sich von abkünftigen Interessen leiten ließ.
Wir haben es mit Hans Küngs ureigener Geschichte der katholischen Kirche zu tun. "Mein Blickwinkel" heißt denn auch der Titel des ersten Abschnittes dieses Büchleins, das "engagiert und sachlich zugleich" geschrieben zu sein beansprucht und dessen Autor "durchaus Eigenes sagen" will. Das Ich des Erzählers ist denn auch in dieser Geschichte unübersehbar präsent - selbst da, wo es sich nicht eigens artikuliert. Was hat dieses Ich zu erzählen, wenn es sich auf die Geschichte seiner Kirche besinnt?
Nach einer die katholische Kirche im Widerstreit von Bewunderung und Herabsetzung positionierenden Einleitung, die die "Ur-Gestalt" Jesu von Nazareth als Kriterium der wahren Kirche behauptet, folgen acht Kapitel Kirchengeschichte, die nach der bekannten Paradigmen-Theorie des Verfassers gegliedert wird. Dabei ist vorausgesetzt, "daß das Papsttum unbestreitbar das zentrale Element im römisch-katholischen Paradigma darstellt".
Die Kirche des Anfangs und die Frage nach dem Anfang der Kirche werden nach allen Regeln historisch-kritischer Forschung im ersten Kapitel thematisiert. Daß der Autor nicht selber als Forscher tätig wird, sondern die Ergebnisse der Forschung resümiert, gilt für das ganze Buch und entspricht dem literarischen Genus eines solchen Sachbuches. Die nächsten Kapitel erzählen die Geschichte der alten katholischen Kirche, der katholischen Reichskirche, der Entstehung der Papstkirche und die Geschichte der - einer totalen Romanisierung sich verdankenden - zwischen Ostreich und Westreich gespaltenen Kirche.
Dann kommt die Alternative von Reform beziehungsweise Reformation und Gegenreformation zur Darstellung. In ihr erfreut den protestantischen Leser die ganz und gar unvoreingenommene Würdigung Martin Luthers. Als Folge der Gegenreformation werden schließlich der Kampf der katholischen Kirche gegen die Moderne und dessen bedrückende Folgen beklagt. Das Schlußkapitel konzentriert sich auf die Rolle der Päpste seit dem Ersten Vatikanum und auf die eminente Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Daß viele vatikanische Entscheidungen als "Verrat am Konzil" erscheinen, soll freilich auch in der "allzu konzilianten" Einstellung des Konzils gegenüber dem Ersten Vatikanum und gegenüber der Kathedra Petri begründet sein.
Am Ende seiner kleinen Geschichte der katholischen Kirche steht der auch dann, wenn man die Selbststilisierung des Autors in Rechnung stellt, deprimierende Satz: "Mit Trauer stelle ich fest: ... Die Päpste und die heutigen katholischen Bischöfe werden für diesen Niedergang vor der Geschichte genauso verantwortlich gemacht werden wie ihre Vorgänger in der Reformationszeit." Doch die Feststellung seiner Trauer ist nicht das letzte Wort, das Hans Küng zur Geschichte der katholischen Kirche zu sagen hat. Das letzte Wort sind Worte: Erklärungen zum Projekt Weltethos und zum Verständnis eines wahrhaft orthodoxen, eines wahrhaft katholischen und eines wahrhaft evangelischen Christenmenschen.
Im einzelnen könnte man allerlei problematisieren. So etwa die Allergie des Verfassers gegenüber dem trinitarischen Dogma, dessen Überkompliziertheit zum Untergang der nordafrikanischen Christenheit wesentlich beigetragen haben soll. Oder das die Darstellung durchziehende "Hätte", "Wäre", mit dem der Autor den Lesern seine Sicht der Dinge als die wahre Einsicht suggeriert. Mitunter verwirrt der Rückgriff auf zuvor Mitgeteiltes, das man jedoch in diesem Büchlein vergeblich sucht, dafür aber in Küngs monumentaler Darstellung "Das Christentum. Wesen und Geschichte" von 1994 findet. Daß die Reformierten den Kirchengesang eliminiert haben sollen, dürfte zumindest den Dichter reformierter Kirchenlieder Huldrych Zwingli überraschen. Und daß ein "katholischer Gorbatschow" die Wende herbeiführen können soll, von der Hans Küng träumt, verrät nun doch eine Fixiertheit auf die Machtfülle des jeweiligen Papstes, die zu überwinden doch gerade zur Aufgabe des "ökumenischen Paradigmas" gehören müßte.
Doch was soll's? Rom ist Rom. Und Küng bleibt Küng. Es wäre gut, wenn beide Sätze nicht im Gestus eines vermeintlich kontradiktorischen Widerspruchs verharren müßten, sondern sich zugunsten einer coincidentia oppositorum vermitteln ließen. Quod Deus bene vertat ...
EBERHARD JÜNGEL
Hans Küng: "Kleine Geschichte der katholischen Kirche". Berliner Taschenbuch Verlag, Berlin 2002. 279 S., br., 9,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
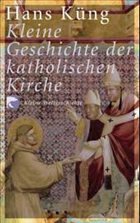




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.05.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 27.05.2002