meiner Großmutter", erklärt ihr der Verkäufer, und Sigune Vorinsfeld, die gerade achtzehn Jahre alt geworden ist, ahnt, daß sie sich einem dunklen Punkt der Vergangenheit ihrer Familie nähert.
Die Frage, wie eine Fotografie, die vor fast hundert Jahren entstanden ist, nach Amerika und dann wieder zurück nach Deutschland gekommen ist, bildet den Ausgangspunkt von Sabine Schiffners weit ausholendem Debütroman "Kindbettfieber". Über fünf Generationen hinweg erzählt die 1965 geborene Schriftstellerin eine Geschichte aus dem verkrusteten Milieu des Bremer Bürgertums, und damit liegt sie zweifelsohne schwer im Trend. Familienromane erfreuen sich in den letzten Jahren wieder einer großen Beliebtheit, und insbesondere in der deutschsprachigen Literatur gibt es eine ganze Reihe von ziemlich erfolgreichen Versuchen, den zersprengten Zeitläuften des zwanzigsten Jahrhunderts die unerschütterliche Kontinuität einer Familiengeschichte entgegenzustellen.
Sabine Schiffner, die für das Manuskript von "Kindbettfieber" mit dem Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung ausgezeichnet wurde, meint es nun sehr ernst damit. "In einer Familie müssen klare Strukturen herrschen", zitiert Sigunes Mutter Frieda eine der von Generation zu Generation weitergegebenen hanseatischen Weisheiten, und für alles, was jenseits dieser "klaren Strukturen" liegt, bleibt in diesem Roman dann auch nur wenig Platz. Die Kriegserklärung des Kaisers, die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg und die Terroristenfahndung in den frühen achtziger Jahren werden zwar pflichtschuldig erwähnt, doch die Bemerkung, daß "das Jahrhundert es nicht nur gut gemeint hat" mit den Vorfahren von Sigune Vorinsfeld, ist ein reines Lippenbekenntnis: Der Niedergang dieser "guten Bremer Familie" hat mit den politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen und Erschütterungen nur wenig zu tun.
Obwohl die Kapitelüberschriften aus Jahreszahlen wie 1911, 1941 oder 1963 bestehen, erscheint Sabine Schiffners Roman dennoch zunächst sonderbar zeitlos - und dann zunehmend antiquiert. Schuld daran ist nicht allein die behäbige und altertümliche Sprache mit ihren endlosen Sätzen und ungelenken Partizipialkonstruktionen. Wenn Sigune "mit der Schule fertig und das Leben vor sich habend" über den Flohmarkt streift und dort nach ihrem Zufallsfund unter der "dunklen, fremden Last" der Vergangenheit von einem Schwindel ergriffen wird, ist das nämlich nicht der Beginn einer Recherche in eigener Sache, sondern einfach nur einer von vielen Momenten, in dem, nun ja: das Verhängnis seinen Lauf nimmt. Kein Wunder also, daß die Verweise auf die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts so dünn ausfallen. "Kindbettfieber" gehört in eine ganz andere Zeit: Dieser Roman besteht aus lauter beunruhigenden Zufällen und düsteren Vorahnungen, und wie in einer Schicksalstragödie aus der fernen Epoche der Romantik tritt die eigentliche Handlung nach und nach hinter einem unheilvollen Raunen zurück. "Etwas ist in unserem Blut", erfährt Sigune unter anderem von ihrer Großmutter Elisabeth, "das hat schon vor langer Zeit angefangen, bei uns ist was falsch."
Sabine Schiffners literarische Ahnen Zacharias Werner und Adolf Müllner hätten es sich auch zusammen nicht schöner ausdenken können: Bei dem, was an dieser Familie "falsch ist", handelt es sich doch tatsächlich um einen sogenannten Erbfluch. Sigunes Vorfahr Heinrich Abken Freudenthal hatte mit einem Dienstmädchen ein uneheliches Kind gezeugt (über das die Abzüge seiner Fotografien im übrigen später nach Mexiko gekommen sind). Er habe eine andere unglücklich gemacht, schrieb er kurz vor seinem Selbstmord in einem Abschiedsbrief, und im gleichen Atemzug verwünschte er zornig seine Frau "und all ihre Kinder und Kindeskinder". Eine Brosche, die aus der Anstecknadel des "ruhelosen" Toten gefertigt wird und von Generation zu Generation weitergegeben wird, wird zum goldenen Träger des Fluchs, und seitdem der alte Freudenthal ins Wasser gegangen ist, kommt es bei den jungen Müttern der Familie zu Sturzgeburten, bedrohlichen Gemütsschwankungen oder zu der heimtückischen Infektionskrankheit, die dem Roman dann auch den Titel gegeben hat: dem Kindbettfieber.
Literarisch ist das ohne Frage sehr ambitioniert. Neben der schmerzvollen Reihe von unglücklichen Geburten zieht sich noch ein ganzes Bündel von aufgeladenen Leitmotiven und Metaphern durch das Buch. Fotos werden verbrannt, um Erinnerungen auszulöschen, gläserne Vogelkäfige künden vom lichten Gefängnis der bürgerlichen Ehe, und immer wieder begibt die Autorin sich hinab in die sumpfigen Niederungen der Naturlyrik, in der das "leise, gleichmäßige Rauschen der Kranichflügel" vom Kindersegen kündet - und der Anblick des frühlingshaften "jungen Grüns" Sigune schließlich als letzte des Geschlechts angewidert in den Gebärstreik treten läßt.
Hier paßt alles, und doch paßt das Ganze einfach nicht in unsere Zeit. Mit "Kindbettfieber" zeigt Sabine Schiffner, daß das gegenwärtig überstrapazierte Genre des Familienromans eigentlich in die Mottenkiste des neunzehnten Jahrhunderts gehört.
KOLJA MENSING
Sabine Schiffner: "Kindbettfieber". Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2005. 333 S., geb., 18,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
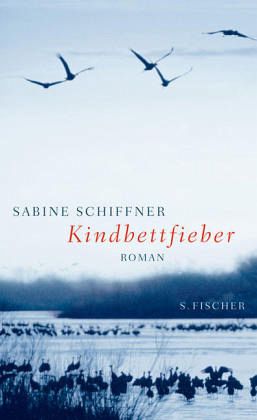




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.01.2006
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.01.2006