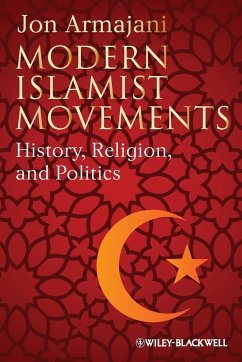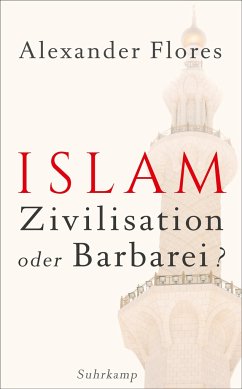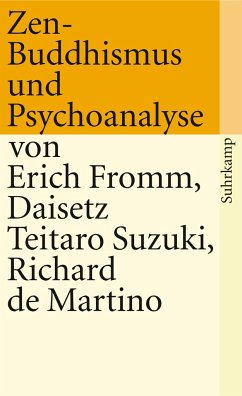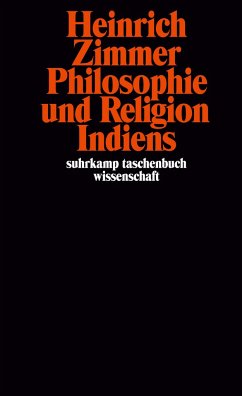schnalzt er mit der Zunge, betritt er nur den türkischen Busbahnhof, und als echter Verführer versteht er es, dem Leser nach solchem Genuß den Mund wäßrig zu machen: "Durch die Türkei zu reisen ist ein Fest für jeden, der sich einer solchen Fahrt würdig zu zeigen weiß. Die tiefe Kraft eines Otogar offenbart sich dem Neuankömmling nicht ohne weiteres . . . er selbst muß ihr auf den Grund gehen, muß lernen, ihre verborgenen Schätze mit diskreter Beharrlichkeit freizulegen."
Die Busbahnhöfe sind beispielhaft für Goytisolos wachen Blick auf das Traditionelle im Gegenwärtigen. Ethnographisch genauen Beobachtungen literarische Form zu geben gelingt ihm in den stärksten Stücken des Buchs vortrefflich, wie etwa bei der Beschreibung nomadischer Reiterkämpfe in der Gegend von Erzurum in Ostanatolien, die noch die Atmosphäre des Ursprungs aus den zentralasiatischen Steppen heraufbeschwören, oder wenn die fiebrige Erwartung einer exotischen Offenbarung für die enthusiasmierte und zugleich erschreckte türkische Männerwelt angesichts der Ankunft russischer "Damen" in der Türkei mit milder Ironie und dem Ausruf "Die Nataschas kommen!" eingefangen wird. Solche zufällig am Wegesrand gesammelten Steinchen werden hier mit viel Feingefühl zu Edelsteinen umgeschliffen.
Das Sammelsurium der Einzelstücke fügt sich zum geschlossenen Mosaik: die schiitischen Passionsspiele in Iran, die den Passionsspielen katholischer Christen nicht unverwandt sind; originelle Reflexionen am jemenitischen Haus über die "kompositorische Vertikalität" als "lichte Allegorie" seiner soziokulturellen Schichten; die Herausbildung neuer Musik aus dem Geist einer "Musik der Trance" in Marokko; die Hommage an die weltberühmte, in ihrer ungebrochenen Vitalität gleichwohl resistent gebliebene Dschemaa al-Fna in Marrakesch; eine Hommage auch an Elias Canetti und seine Stimmen von Marrakesch; schließlich - nehmen wir es als einen der Höhepunkte - "Cinéma Eden", eine Liebeserklärung an den indischen Film vor marokkanischem Publikum, an dessen Ende wir Goytisolo aufstehen und dem Film spontan Beifall klatschen und das Kinopublikum mitreißen sehen.
Etwas weniger erhebend sind seine politischen und historischen Einlassungen. Es ist ihm offenbar ein Anliegen, mit wissenschaftlicher Terminologie seinen Objektivitätsanspruch zu unterstreichen. Ein Satz wie "Der auf Saaba und den Norden konzentrierte saiditische Schiismus koexistiert mit einer sunnitischen Mehrheit schafiitischer Ausrichtung, daneben aber hat der zunächst türkische, später wahabitische Einfluß seinen Niederschlag in der Existenz hanefitischer und hanbalitischer Gruppen gefunden" dürfte dem islamwissenschaftlich nicht vorgebildeten Leser kaum Lichter aufstecken. Für den Islamwissenschaftler aber ist der so geraffte Inhalt blanker Unfug. Am deutlichsten zeigen sich diese Schwächen im ersten Kapitel "Islam, Wirklichkeit und Legende". Goytisolo möchte hier wohl gleich zu Beginn das Bild des Westens vom Islam geraderücken. Das Kapitel gerät dadurch zu einer Apologie des Islams als einer Religion der Toleranz, stets im Gegensatz zum christlichen Pendant. Das ist eine beliebte Mogelpackung, in der auf der einen Seite die unterschiedlichsten Verfehlungen der Christen von den Kreuzzügen bis zum Kolonialismus aufgezählt werden, während auf der anderen unablässig die Toleranz der Muslime gegenüber Andersgläubigen gerühmt wird. Das Schema dürfte für Goytisolos Heimat Spanien zutreffen, sonst aber bestenfalls für die frühe Zeit der Omaijadenherrschaft, die der Autor an anderem Ort jedoch eher abwertend durch die schiitische Brille beurteilt. Als ob es nie Christenmassaker in Damaskus, Armenierverfolgungen, Vertreibung von Juden aus Marokko und ähnliches gegeben hätte!
Der Abbau von Vorurteilen und das wechselseitige Verständnis gedeihen nicht auf historischen Schuldzuweisungen. Blut an den Händen haben alle. Nur, daß sich die säkularisierten Christen des Westens, politisch korrekt, wie sie zu sein meinen, seit geraumer Zeit wieder auf alte Tugenden besinnen und auch noch die andere Backe hinhalten, um mit Hingabe den Watschenmann für diejenigen irgendwo in der Welt zu spielen, die davon zu profitieren verstehen. Die historischen Analysen Goytisolos, der diese vertrackte Dialektik noch nicht ganz durchdrungen zu haben scheint, muten wie hölzerne Darbietungen von Angelerntem in einem Pflichtprogramm an. Seine beschwingte Kür hinterläßt glücklicherweise einen nachhaltigeren Eindruck.
Ein kleines Glossar fremdsprachiger Worte und Begriffe hätte der Verlag dem Bändchen gönnen dürfen. Es sei denn, in unserem sprachgewandten Land könnte die Kenntnis persischer oder arabischer Worte wie khema für "Zelt" bei den Lesern als selbstverständlich vorausgesetzt werden.
GENNARO GHIRARDELLI.
Juan Goytisolo: "Kibla - Reisen in die Welt des Islam". Aus dem Spanischen übersetzt von Thomas Brovot und Christian Hansen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2000. 237 S., br., 19,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
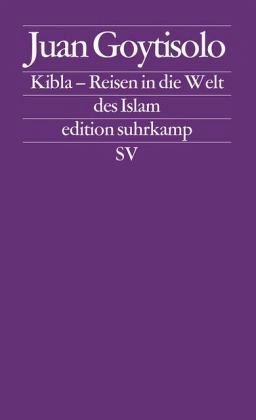




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.09.2000
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 07.09.2000