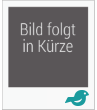Nicht lieferbar

Keiner zu Hause
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Mit trügerischer Leichtigkeit durchstreift Dubravka Ugresic in ihren neuesten Essays Orte und Kulturen, Zeitgeschichte und Politik, richtet unser Augenmerk auf die universelle Bedeutung scheinbarer Alltagsbanalitäten wie Evian-Wasser und Vogelhäuschen und betrachtet umgekehrt die ganz großen Themen mit nonchalanter Unverfrorenheit durch die allerkleinste Linse - so zum Beispiel, wenn sie die Welt nach 9/11 aus der Perspektive der New Yorker Nagelstudios analysiert. Es entsteht ein ebenso scharfsinniges wie humorvolles Bild der mentalen Koordinaten unserer Zeit - dank der überragenden Qual...
Mit trügerischer Leichtigkeit durchstreift Dubravka Ugresic in ihren neuesten Essays Orte und Kulturen, Zeitgeschichte und Politik, richtet unser Augenmerk auf die universelle Bedeutung scheinbarer Alltagsbanalitäten wie Evian-Wasser und Vogelhäuschen und betrachtet umgekehrt die ganz großen Themen mit nonchalanter Unverfrorenheit durch die allerkleinste Linse - so zum Beispiel, wenn sie die Welt nach 9/11 aus der Perspektive der New Yorker Nagelstudios analysiert. Es entsteht ein ebenso scharfsinniges wie humorvolles Bild der mentalen Koordinaten unserer Zeit - dank der überragenden Qualitäten dieser Autorin: ihres "unbestechlichen Urteils, ihrer polemischen Schärfe, ihres poetischen Flairs, ihres sarkastischen Witzes". (Ilma Rakusa).