erfahren, daß die Autoren aus dem Zusammenbruch des Sozialismus und der chronischen Krise des Wohlfahrtsstaates nichts gelernt haben. Überraschend würzt Oskar Lafontaine die Collage etwas mit Ludwig-Erhard- und Walter-Eucken-Zitaten, mit denen sonst das Buch herzlich wenig gemein hat.
Den Sieg der Marktwirtschaft ("Neoliberalismus") halten sie für einen Sieg der Reaktion über die "Moderne", sie warnen wie Nationalkonservative vor Wertzerstörung durch "Marktradikalismus", geben sich als Bewahrer von Familie, Nation und Staat. Vor allem der Standortwettbewerb zwischen nationalen Steuer-, Sozial- und Bildungssystemen als Folge der "Globalisierung" liegt ihnen schwer im Magen, da es auf diese Weise zu einem Druck auf die Staaten kommt, ihre Betriebskosten zu senken und ihre Agenda einzuschränken. Sie fordern gegen diesen Wettbewerb besitzstandssichernde Kartelle der Nationalstaaten durch die Vereinbarung von zwingenden internationalen Mindeststandards (in bezug auf Steuerhöhe zum Beispiel, soziale Versorgung, Umweltstandards). In diesem Sinne treten sie auch für forcierten Euro-Zentralismus ein, sogar für eine europäische Wirtschaftsregierung, für eine gemeinsame Beschäftigungs- und Tarifpolitik. Wie die unbeirrbaren Keynesianer halten sie den Staat für fähig, Konjunktur und Wirtschaftswachstum nach Willen der Politik zu steuern. Gegenläufige Erfahrung sind für sie kein Argument. Den sozialen Bevormundungsstaat wollen sie als Teil der "deutschen Identität" nicht nur erhalten, sondern noch weiter ausbauen (Versicherungszwang auch für Unternehmer, Mindestrente über dem Sozialhilfeniveau, Mindesteinkommen, Sozialisierung der Familienkosten). Außerdem wünschen sie staatliche Ganztagskindergärten und Ganztagsschulen. Bei den Wohlhabenden, meinen sie, müßte der Staat mehr zulangen; alle sollen relativ gleiche Opfer bringen. Und sie halten es sogar für die Sache der Politik, sich um "Unternehmenskultur" (vor allem im Sinne von mehr Arbeitnehmerdemokratie) zu kümmern. Für den Arbeitsmarkt empfehlen sie die italienischen und französischen Modelle - also die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nicht durch Einschränkung der Arbeitsmarktkartelle, sondern durch Rationierung der Arbeit, Arbeitszeitverkürzung und umfassende Ausbildungsprogramme. Was die beiden Autoren bieten, ist kein Modernisierungsprogrogramm für Deutschland, ihr ökonomisches Gedankengut schließt direkt dort an, wo die Sozialdemokratie 1982 hat aufhören müssen.
GERD HABERMANN
(Unternehmerinstitut UNI/Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer ASU)
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
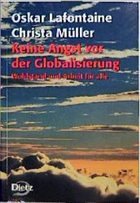




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 31.08.1998
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 31.08.1998