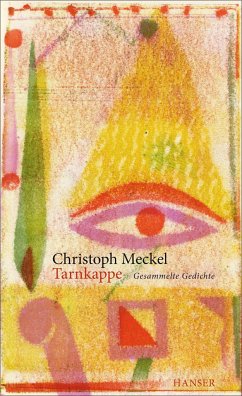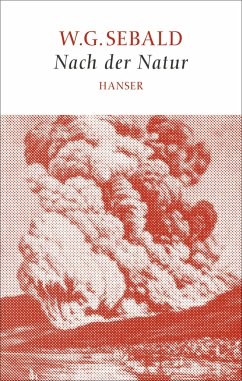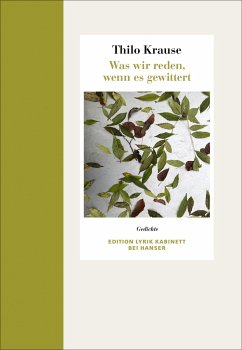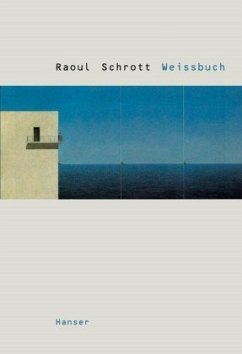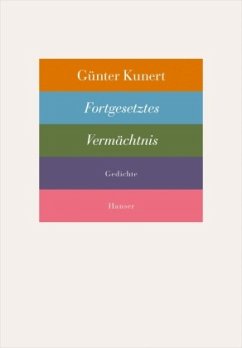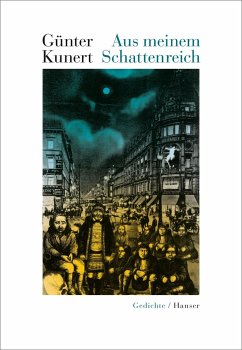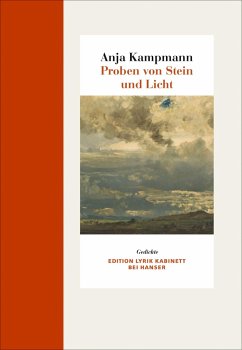zurück bleiben Wüstenstaaten ohne Wein und Apfel." Immer weiter muss der Alte gehen, denn: "Sesshaft in der verbrauchten Welt, das ist unzumutbar." Doch wie ein Hintergrundrauschen gibt der Genitiv "Blindenführer des Unbekannten" gleichfalls zu verstehen, dass da einer nicht nur den Unbekannten, sondern auch durch das Unbekannte führt. Wir sind also an der Seite des Ichs mit dem Blinden, und wir irren, selbst nach Orientierung tastend, vertrauend, durch einen abgründigen Text. Hungrig nach anschaulichen Erzählmomenten.
Der jüngste Lyrikband von Christoph Meckel (Jahrgang 1935), "Kein Anfang und kein Ende", besteht aus zwei verschwisterten Langgedichten: "Dunkelstrecke" und "Meer! Meer!". In Überblendungen von Endzeitlichkeiten variieren sie die große Melancholie eines großen Dichters. Der Tod erscheint nicht als Abschluss des Lebens, sondern das Leben als eine Variante des Todes. "Was ich gesehn hab", sagt der Alte, "ist vor mir gestorben, / Ich hab es gesehn, jetzt hat es ein Grab, das lebt / und läuft herum, blind, ohne Tod und Friedhof." Ein anderes Mal erscheint ein Friedhof am Hang als Arche Noah einer kleinen Berggemeinde. Christoph Meckel nimmt frei Bezug auf archaische Mythen, die Bibel oder Sagengestalten des eigenen Werks. In einem barock anmutenden Vertrauen ins Wort, in dessen evozierende Kraft, öffnet er seelische Weltlandschaften und macht aus der irdischen Not des Menschen ein berührendes Abenteuer.
Beide Langgedichte sind durch Paarkonstellationen und dialogisches Sprechen geprägt. Oft kommen - in Großbuchstaben abgesetzt - weitere Stimmen oder Stimmlagen, Gesungenes, Gereimtes hinzu. Das gibt den Langgedichten etwas Oratorienhaftes. "Dunkelstrecke" erzählt in Szenen vom Verhältnis "Leitbursch" und Blinder. "Tickelt er mit der Stockspitze auf die Steine, / und was tief unten vor ihm auf der Piste herumliegt, / tot, halbtot, lebendig, geprügelter Hund, / Reste von Rädern und Krügen, zertrampelte Kröte, / Abfall der Bordelle, verpisste Knochen, / damit der Alte drüberrutscht und hinschlägt." Doch der Blinde kommt immer wieder hoch, und sein Bursche hilft ihm, er ist mit seiner Arbeit einverstanden, auch wenn er lieber mit einem "Schwarzpelzbären" unterwegs wäre, der "im Kreis stampft auf den Hintertatzen", brummt und sich freut, "wenn in den Dörfern Kinder lachen." Aber schon als reines Traumbild, als Utopie, erhellt der Bär die Trübnis der Tage.
"Dunkelstrecke" handelt auch von zwischenmenschlicher Macht. Der Blinde hat die Autorität, das Geld. Aber der, der sieht, kann seine Imagination leiten. Er schafft Wirklichkeit. Die Maschinen der Fischfabrik dröhnen und werden, wenn der Leitbursch es will, im Kopf des Blinden zur Seeschlacht draußen auf dem Wasser.
Schon in "Dunkelstrecke" sind erotische Momente angelegt. Einmal kauft man einen Karren, nimmt eine Prostituierte mit, der Blinde greift lüstern nach ihrem Bein, aber der Bursche schlägt ihm aufs Gelenk und wird bald selbst der Geliebte der Frau, mit der er "in den Binsen atmete und spielte". Für sie wird er den Blinden verlassen, und ein nächster Leitbursch, nun heißt er "Lotse", wird im Reigen von ihm als Vorgänger erzählen. Die Zeit hat jetzt Supermärkte, Autobahnen, Motels. Man ist mit einem Jeep unterwegs. Der Blinde heißt "Irgend", und ihre Abenteuer kennen Kahlgeschorene mit Schlagstöcken, begleitet vom "Menschenfresser, / das war der Hund".
"Meer! Meer!" verdichtet das ambivalente Herr-und-Knecht-Motiv hin zur Lebensinnigkeit zweier Liebender, in der Eros und Agape zusammenkommen. Aus dem Gebirge, den Regionen von Gletscher und Murmeltier, sind sie auf dem Weg hinunter ans Meer. "In der Nähe ein Bergsee, Eiswasser ohne Fische, / Spiegel, unter den Weltraum geschoben, / Vogelschwärme und Jumbos verloren in ihm ihre Spur." Doch auch ihre Landschaft ist schon überlebt, in der Ebene "irrlichternd in Verfaulung, schnalzend von Blasen der Gärung".
Was sich rein erhält, ist getaucht in Empathie und Vertrauen. Es überlebt im Erinnern an die grüne, blaue Frühzeit der Liebe, paradiesisch, "auf dem Grasfleck im Bergland", im Sagen der Namen, im Sich-Vergewissern, dass der andere da ist und deshalb Dasein schafft. Was gut war, gilt; wenn es sprachlich noch einmal aufgerufen werden kann, ist es der für beide sichere Bezug. Der Liebende begleitet die müde, kranke Geliebte sprechend in ihrem Sterben ("Erzähl die Geschichte vom Vogel. / Du kennst sie. / Erzähl sie noch einmal.") Dann nimmt er die Tote auf die Schulter, "als sei sie die geraubte Braut". Aber auch nachdem er sie unter Steinen begraben hat, kommt sie als Stimme zurück. Und er durchquert mir ihr (Text-)Passagen, die sie einst zusammen durchstreiften.
Der Leser erkennt die kleinen Variationen, statt "helle Frühjahrsnächte" etwa sind es nun "nasse Oktobernächte". Raum und Zeit sind "durcheinandergefallen", und der Wandernde hält sich "in unbekannten Jahreszeiten" auf. "In Schleiern aus Spleen und Irrsein" begegnet er seltsamen Gestalten, die wie er auf dem Weg sind hinunter zum Meer. Und es nicht erreichen. In einem letzten, dialogischen Sich-Einstimmen mit der toten Geliebten ("Sprich mir nach!") gelingt aber eine Elevation, die erfahrbar macht, dass in der Wirklichkeit der Sprache die Grenze zwischen Tod und Leben unerheblich geworden ist.
Christoph Meckel: "Kein Anfang und kein Ende". Zwei Poeme.
Carl Hanser Verlag, München 2017. 96 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.11.2017
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 25.11.2017