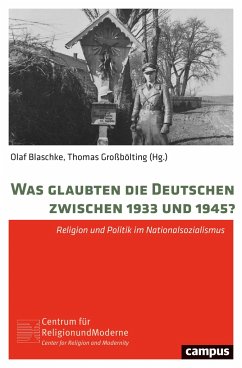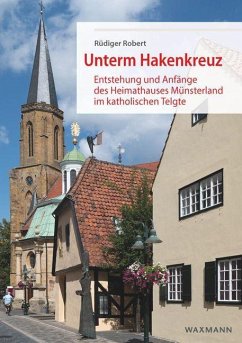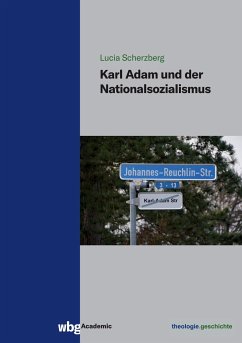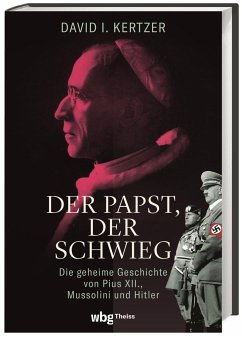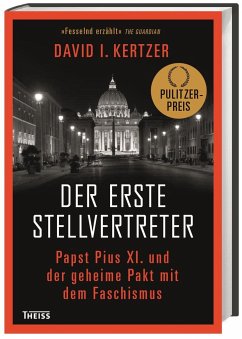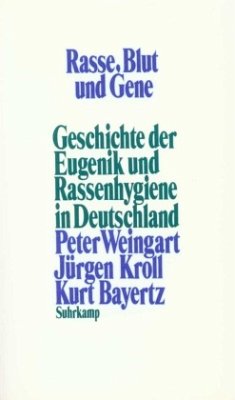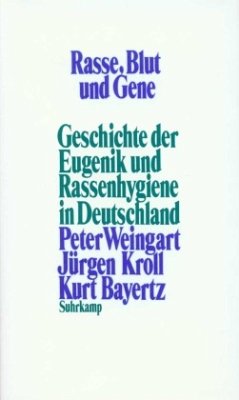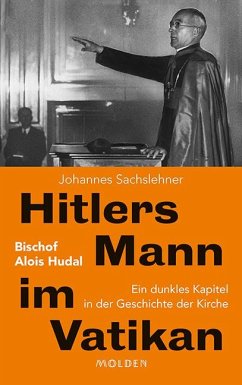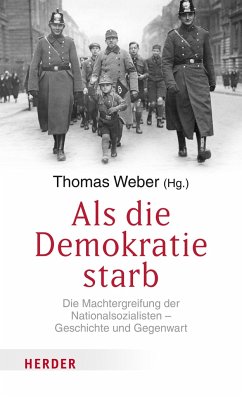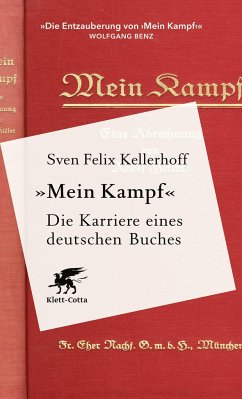Juli 1933 im Auditorium Maximum seiner neuen Universität gehalten hat.
Schmaus gehörte zu denjenigen Stimmen im katholischen Deutschland, die in den Monaten nach Hitlers Machtergreifung eine Annäherung an den Nationalsozialismus legitimierten, ja zur Pflicht erklärten. Für Wortmeldungen dieser Art, die zuvor kaum vorstellbar gewesen waren, richtete der traditionsreiche Verlag Aschendorff unter dem Titel "Reich und Kirche" eine eigene Schriftenreihe ein. Zu den Autoren der insgesamt fünf Hefte, die 1933/34 erschienen, gehörten neben Schmaus und Hitlers Vizekanzler Papen der Kirchenhistoriker Joseph Lortz und der junge Philosoph Josef Pieper - Persönlichkeiten, die auch nach 1945 den deutschen Katholizismus prägen sollten.
Ihnen widmet Kurt Flasch sein neuestes Buch. Dass die Texte der genannten Reihe bislang "nicht nach Argumentation, Zusammenhang und geschichtlichem Ort untersucht" worden seien, wie es im Vorwort heißt, ist nicht ganz richtig. Martino Patti hat bereits 2008 eine italienische Übersetzung aller Beiträge mit ausführlicher Einleitung vorgelegt. Auch insgesamt berücksichtigt Flasch die umfangreiche Literatur zum Thema "Katholische Theologie im Nationalsozialismus" nur selektiv. Neue Quellen erschließt er kaum. Er selbst charakterisiert seinen Beitrag als "einen wohldokumentierten Essay, kein Handbuch". Das erlaubt die Konzentration auf exemplarische Wortmeldungen und eröffnet Raum für Exkurse und Anekdoten. Seine Bewertungen formuliert der Verfasser in ungefilterter Schärfe. Die selbst auferlegte Vorgabe, Fragen zu stellen, die "ideengeschichtlich, (. . .) nicht moralisch" sind, lässt er zuweilen hinter sich. Spätestens im Resümee gibt Flasch zu verstehen, dass er die von ihm untersuchten Texte als "intellektuelle Verbrechen" einstuft, angesichts derer den Leser auch heute noch "politisch-moralische Abscheu" befalle.
Als "Vorredner" der Hauptakteure werden einflussreiche Katholiken präsentiert, die sich schon im Frühjahr 1933 auf die Seite Hitlers schlugen und deren Impulse nachwirkten: Karl Adam, Karl Eschweiler, Carl Schmitt, Franz von Papen. Die im Hauptteil des Buches behandelten drei Beiträge der "Reich und Kirche"-Serie setzen bereits den Pfingsthirtenbrief der deutschen Bischöfe, den Abschluss des Reichskonkordats und die Auflösung des Zentrums voraus. In seinen kommentierenden Paraphrasen weist Flasch unerbittlich, zuweilen sarkastisch auf, wie die katholischen Brückenbauer nazistische Propagandasprache übernahmen, demokratiefeindliche Überzeugungen äußerten und rassistische Stereotype bedienten. Die antichristlichen Tendenzen der NS-Bewegung wurden heruntergespielt, indem man Hitler von Rosenberg trennte und sich auf Inhalte des Parteiprogramms berief ohne Beachtung der faktischen Entwicklungen in Deutschland. Man bejubelte die Überwindung des politischen Katholizismus und erhoffte sich als Nebenprodukt der Reichseinung die Überwindung der Kirchenspaltung. In der nationalen "Zeitenwende" sollte sich auch die Kirche reformieren.
Anknüpfungspunkte für die Vermittlung von Katholizismus und Nationalsozialismus sahen die Autoren im Kampf gegen den Kommunismus, in der Ablehnung von Liberalismus, Subjektivismus und Intellektualismus, in der Wertschätzung von Volk und Familie, Hierarchie, Opfer und Gehorsam. Wiederholt begegnet man der fixen Idee, dass durch die NS-Weltanschauung eine Restitution jenes "natürlichen Menschen" zu erwarten sei, der dann von der Kirche seine gnadenhafte Vollendung erbitte. Hier wähnten Theologen, den Nationalsozialismus besser zu verstehen als dieser sich selbst.
Flasch entlarvt die politische Naivität solcher Konstrukte und die Haltlosigkeit ihrer abstrakten Begründungen. Eschweilers oberflächlichen Thomismus oder Piepers schablonenhaftes Mittelalterbild lässt er ebenso wenig durchgehen wie die Verzeichnung Kants durch Schmaus und die abschätzige Bewertung des Humanisten Erasmus in der dogmatisch gefärbten Geschichtsanalyse des NSDAP-Mitglieds Lortz. Ideologische Verblendung, so legen Flaschs Analysen nahe, verband sich nicht selten mit schlechter Wissenschaft. Vernichtend fällt das Urteil über den später zum Bestsellerautor avancierten Josef Pieper aus. Flasch beleuchtet nicht bloß Piepers literarischen Anbiederungsversuch von 1934, der das "Arbeitsrecht des Neuen Reiches" pries. Generell attestiert er ihm "ein Defizit an Philosophie und das Aufblasen von Worthülsen" und charakterisiert ihn mit Berufung auf einen Nachkriegsbrief des Habilitationsgutachters Gerhard Krüger als Dilettanten, der in der seriösen Forschung ignoriert werden durfte.
Auf innerkatholische Kritik, mit der sich einige der behandelten Theologen schon während der NS-Zeit auseinanderzusetzen hatten, geht Flasch ebenso nur am Rande ein wie auf die Wirkungsgeschichte ihrer Schriften oder das Verhältnis der Autoren zueinander. Undeutlich bleibt, dass sich damals staatsnahe Rechtskatholiken keineswegs als ultramontane Reaktionäre gerierten, sondern unter der Flagge des theologischen Aufbruchs segelten; kirchenpolitisch sind sie daher nicht leicht einzuordnen.
Flasch kennt die Argumente, die katholische NS-Sympathisanten nachträglich zu ihrer Entschuldigung vorgebracht haben. Gelten lässt er sie nicht, zumal er in der eigenen Familie erlebt hat, was Katholiken erleiden mussten, die ihrer Absage an das Hitler-Regime treu blieben. Dennoch versucht er zu begreifen, wie intellektuelle und spirituelle Motive des antimodernen Katholizismus einige seiner Vertreter dazu brachten, sich als Wegbereiter des Nationalsozialismus anzubieten. Das, so ist Flasch überzeugt, muss auch heute noch "Katholiken beunruhigen und Nicht-Katholiken beschäftigen". THOMAS MARSCHLER
Kurt Flasch: "Katholische Wegbereiter des Nationalsozialismus". Michael Schmaus, Joseph Lortz, Josef Pieper.
Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2021. 192 S., br., 24,80 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
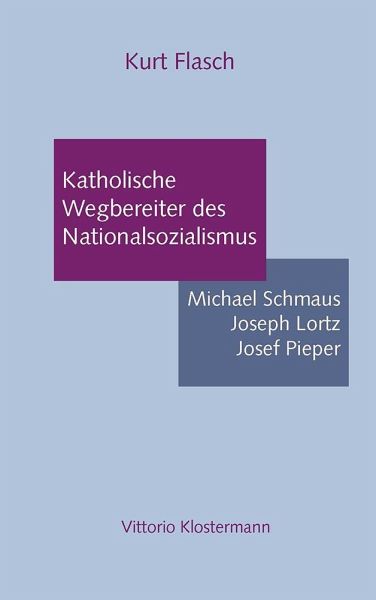




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.12.2021
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.12.2021