Ganzes; und er weiß, dass dies nach Erzählung verlangt.
In der Tat, Geschichte will erzählt sein. Ohne Erzählung verharrt sie in hoch spezialisierten Gelehrtenzirkeln, die, der Erforschung irgendwelcher Vergangenheiten verschrieben, sich mit sich selbst unterhalten, dringt sie über deren Kreise nicht hinaus in das kulturelle Gedächtnis der ganzen Gesellschaft, die doch nach Erzählung dürstet, auch jene selbstgenügsamen Gelehrten finanziert, und verwehrt sie dieser Gesellschaft damit im Letzten Selbstbewusstsein, Selbstkontrolle und Zukunftsplanung. Die deutsche Mediävistik der Nachkriegsjahrzehnte tat sich freilich - von wenigen Ausnahmen wie Arno Borst oder Horst Fuhrmann abgesehen - besonders schwer, die unabdingbare Notwendigkeit der Geschichtsschreibung zu erfüllen. Nur allmählich beginnt es sich zu ändern. So darf man dankbar sein für jedes seriöse Unternehmen, das mit dieser Art Abstinenz bricht und eine Vergangenheit zu gestalten versteht, die unserer Zeit fremd geworden ist, ohne doch bedeutungslos für sie zu sein.
Das Buch (ihm ist als erster Band "Theophanu und der König: Otto III. und seine Welt" vorausgegangen; F.A.Z. vom 5. Dezember 1996) setzt 996 mit der Kaiserkrönung des jugendlichen Herrschers ein, folgt im Wesentlichen der Chronologie der Ereignisse und mündet in einen "Nachruf" auf den früh verstorbenen, genialen Jüngling.
Die Begegnung mit Gerbert von Aurillac und Adalbert von Prag auf der römischen Krönungssynode, die gescheiterte (erste) Werbung um eine purpurgeborene Prinzessin aus Byzanz, die Reisestationen im Reich nördlich und südlich der Alpen, des Kaisers "Freundschaft" mit jenem Adalbert, die Gestaltung der sich etablierenden Fürsten- und Königtümer im Osten des Reiches unter dem Eindruck des Martyriums ebendieses Adalbert, die Ausweitung der lateinisch-christlichen Kulturgemeinschaft nach Osten und Norden, die Entwicklung in Italien und der Stadt Rom, die programmatische "Erneuerung des Römerreiches", die Eickhoff zu Recht wieder stärker hervorhebt, als es in jüngster Zeit der Fall war, das Strafgericht über die Römer, die Gelehrten und Frommen in Ottos Umkreis, seine Anstrengungen um die eigene Bildung, Ottos eigentümliche, Kasteiungen suchende Religiosität, seine Bußgesinnung und Bereitschaft zu kirchlichen Reformen - das sind die Zwischenstationen. Sie folgen in der Regel den Bahnen, die vor Jahrzehnten schon Mathilde Uhliz, Autorin der immer noch grundlegenden Jahrbücher Ottos III., ebnete. Zahlreiche Karten und Bildskizzen erleichtern die Orientierung und erhöhen die Anschaulichkeit.
Eickhoff schöpft aus einer breiten Kenntnis der wissenschaftlichen Literatur, die freilich gelegentlich einseitig ausgewählt ist und nicht immer mit der nötigen kritischen Distanz verwertet wird. So wird das Wartheland ohne weiteres mit der älteren Literatur als Siedlungsgebiet der "Polanen" ausgegeben, obwohl dieses Volk in keiner mittelalterlichen Quelle erscheint und vermutlich ein Konstrukt späterer Zeiten, vielleicht sogar erst des romantischen neunzehnten Jahrhunderts ist. Zuweilen irritieren Anachronismen. Die römische "Kurie" nimmt die Zeit seit der Kirchenreform des späteren elften Jahrhunderts vorweg, "Außenpolitik" setzt einen spätmittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Staatsbegriff voraus, der allen christlich-universalkirchlichen Intentionen widerspricht, die Otto III. auch nach Eickhoff im Blick hatte. Wo war da "innen", wo "außen"? Wirklich Neues wird nicht vorgelegt, bislang unbeachtete Quellen werden nicht entdeckt, keine neuen Interpretationsansätze vorgestellt, keine etablierte Auslegungstradition wird kritisiert oder gar korrigiert. Gelegentlich werden die Quellen auch missverstanden. So verläuft, was für die Beurteilung der politischen Zusammenhänge von einiger Bedeutung ist, die 995 umrissene, bald wieder verworfene Grenze des Bistums Meißen keineswegs vom Elbsandstein- "über das Lausitzer, Iser- und Riesengebirge zur Quelle der Elbe", sondern von der Quelle der Elbe abwärts zur westlichen Region um das Elbsandsteingebirge. "Von der Quelle" und "abwärts" - "inde deorsum" - erlauben gerade nicht, dem von der Urkunde nicht erwähnten Gebirgskamm, sondern gebieten, dem Lauf der Elbe zu folgen. Die Diözese sollte weit nach Böhmen hineinreichen und auch Libice, Heimat des heiligen Adalbert, mit einschließen.
Überhaupt unterschätzt Eickhoff das Gewicht des Kirchenrechts. So hat er den kanonischen Vorbehalt, den der Bischof Unger von Posen gegen die Gründung des Erzbistums Gnesen im Jahr 1000 erhob, nicht recht zu würdigen gewusst. Diese Schwäche teilt er freilich mit vielen Mediävisten. Unger konnte nicht "mit seiner Diözese" außerhalb der neuen Kirchenprovinz bleiben, denn die Legitimität dieser Ausgrenzung der Diözese hatte er bestritten. Auch sieht sich Boleslaw III. der Rote von Böhmen, mit seinem Vater Boleslaw II. verwechselt. Der Unterschied zwischen Eremitentum und Mönchtum sollte deutlicher gefasst werden, als es tatsächlich geschieht.
Aber das alles sind Einzelheiten, die, richtig gestellt, tatsächlich bloß das eine oder andere Detail oder Urteil verändern. Wichtiger erscheint der Blick auf das Ganze, der weite Horizont, in den Eickhoff die Geschichte Ottos III. einbettet. Hier erschließen sich auf Schritt und Tritt neue Perspektiven und überraschende Ausblicke. Da werden nicht nur kenntnisreiche Exkurse und nützliche Hinweise auf die innere Geschichte von Byzanz, der Rus, der Westslawen und Ungarn, Skandinaviens bis hin nach Island, Grönland und "Vinland", also Amerika, neben Italien, dem Reich der Kapetinger oder dem christlichen und muslimischen Spanien eingeblendet, mithin ein Bild von der Welt um Otto III. entworfen - da wird vor allem "Europa bis zu seinen äußersten Grenzen" sichtbar, rückt seine Bevölkerung näher zusammen und wird die Vision einer europäischen Geschichte umrissen, in der die komplexen Wechselbeziehungen zwischen den Fürsten, den werdenden Völkern und einander noch fremden Kulturen hervortreten; da scheint sich um die Jahrtausendwende die Zeit zu beschleunigen: "Veränderungen jagen einander, neue Räume schließen sich auf. Der Atem der Schöpfung geht schneller. Untergangs-Ängste verdunkeln den Horizont, blendende Hoffnungen reißen ihn auf. Es wächst ein Verlangen nach Reinigung und Reform, und radikale Erneuerer finden opferbereiten Anhang."
Hier fließen eigene Erfahrungen des Autors in die Konzeption und Darstellung ein; und manchmal hätte man sich weniger Details und mehr dieser großen Konturen gewünscht, die Eickhoff zu formen versteht. Die Gleichzeitigkeit eines mitunter recht divergierenden Geschehens auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Regionen gewinnt Gestalt. Hier, "im Abendland, hatte man begonnen, die christliche Ökumene ins Auge zu fassen: vom Nordatlantik bis in die Diaspora in Palästina, Ägypten und Andalusien, von Irland bis Ostanatolien, von der Biskaya zum Don." Von solcher Sicht profitieren zuletzt auch die angesprochenen Einzelheiten; denn erst in diesem Kontext, im "Panorama des sich verwandelnden Abendlandes", gewinnen sie ihr Profil. So gesehen bietet Eickhoffs Werk einen bedeutenden Beitrag zur Geburt und zur allmählichen Konstituierung eines Europa, das sich im Zentrum der Welt wusste und dem damals kommenden Jahrtausend sein Gesicht aufprägen sollte.
Ekkehard Eickhoff: "Kaiser Otto III.". Die erste Jahrtausendwende und die Entfaltung Europas. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 1999. 488 S., 41 Abb., geb., 68,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
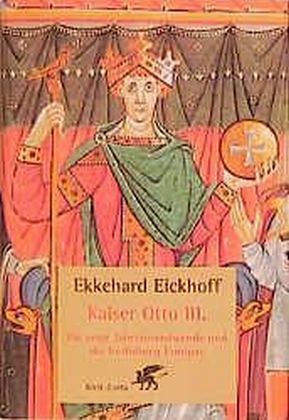





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.10.1999
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 12.10.1999