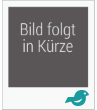Nicht lieferbar

Kaiser Julian
Der letzte heidnische Herrscher
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Julian (361-363) gilt als der letzte heidnische Kaiser. Obwohl er eine christliche Erziehung erhielt, interessierte er sich mehr für die Kultur der klassischen Antike. Julian studierte daher in Ephesos und Athen Philosophie. Seine Politik war von dem Bestreben geprägt, heidnische Traditionen wiederzubeleben und das Christentum zurückzudrängen. In den christlichen Schriften wurde er deshalb Apostata (Abtrünniger) genannt. Gleichzeitig war Julian ein erfolgreicher Feldherr, der bei seinen Soldaten beliebt war. Die Legionen waren es auch, die ihn zum Augustus ausriefen. Seine Regierungszeit ...
Julian (361-363) gilt als der letzte heidnische Kaiser. Obwohl er eine christliche Erziehung erhielt, interessierte er sich mehr für die Kultur der klassischen Antike. Julian studierte daher in Ephesos und Athen Philosophie. Seine Politik war von dem Bestreben geprägt, heidnische Traditionen wiederzubeleben und das Christentum zurückzudrängen. In den christlichen Schriften wurde er deshalb Apostata (Abtrünniger) genannt.
Gleichzeitig war Julian ein erfolgreicher Feldherr, der bei seinen Soldaten beliebt war. Die Legionen waren es auch, die ihn zum Augustus ausriefen. Seine Regierungszeit war jedoch von Einfällen der Perser in das römische Reich geprägt, so dass er 363 zu einer Schlacht gegen den Feind aufbrach, in dessen Verlauf er tödlich verwundet wurde.
Klaus Bringmann zeichnet in dieser Biographie den ungewöhnlichen Weg des 'Abtrünnigen' nach, dessen kurze Regierungszeit viele seiner Pläne unvollendet ließ und deshalb die Phantasie der Nachwelt anregte.
Gleichzeitig war Julian ein erfolgreicher Feldherr, der bei seinen Soldaten beliebt war. Die Legionen waren es auch, die ihn zum Augustus ausriefen. Seine Regierungszeit war jedoch von Einfällen der Perser in das römische Reich geprägt, so dass er 363 zu einer Schlacht gegen den Feind aufbrach, in dessen Verlauf er tödlich verwundet wurde.
Klaus Bringmann zeichnet in dieser Biographie den ungewöhnlichen Weg des 'Abtrünnigen' nach, dessen kurze Regierungszeit viele seiner Pläne unvollendet ließ und deshalb die Phantasie der Nachwelt anregte.