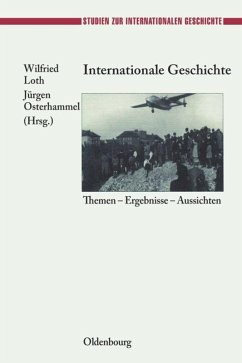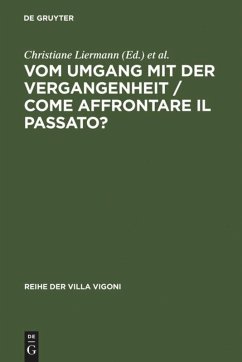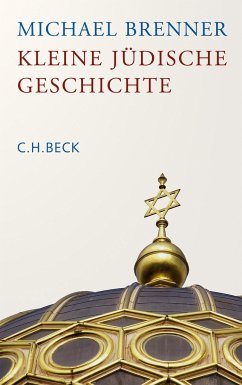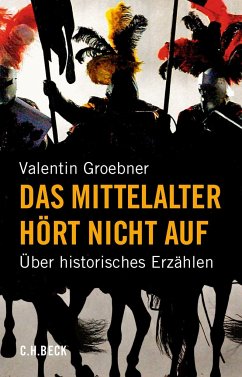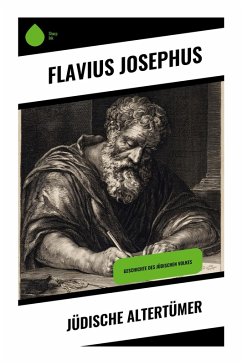der Gegenwart zu diskutieren (F.A.Z. vom 27. Juli 2000). Damit war die sakrale Zeit, die diesen Fragen ihre Tiefe verleiht, methodisch zwar ausgeblendet, aber auch der Rahmen einer säkularen Fachdisziplin kann das Feld nicht wirklich eingrenzen. Das macht jetzt der von Michael Brenner und David N. Myers hervorragend edierte Tagungsband sichtbar, der die Diskussionen dokumentiert. In sechs Kapiteln stellt er einige der Gegensätze vor, die diesen Forschungsbereich polarisieren.
In einem der Kapitel - "Religion und Modernisierung" - wird die Grenzlinie zwischen sakralem und historischem Selbstverständnis thematisiert. Der Israeli Shmuel Feiner, der an der religiösen Universität Bar Ilan lehrt, stellt den Eintritt der Juden in die Neuzeit als einen traumatischen Kulturschock dar. Er führt zehn historische Werke an, die ihm als orthodoxen Juden geholfen haben, den schwierigen Weg nachzuvollziehen, und er macht auf den Schmerz aufmerksam, der überall in den Quellen aus dem achtzehnten Jahrhundert anklingt.
Gelassener sieht es Steven M. Lowenstein aus Los Angeles. Als amerikanischer Jude ist ihm die Moderne eine Selbstverständlichkeit, und als Vertreter einer religiösen Minderheit ist er zu Kompromissen bereit, die er in einer pluralistischen Gesellschaft auch von der christlichen Mehrheit erwartet. Vollends objektiviert der Münchner Theologe Friedrich Wilhelm Graf schließlich das Thema. Sein Forschungsgebiet ist der deutsche liberale Kulturprotestantismus, und er schlägt vor, die Fragen der Modernisierung komparatistisch zu behandeln, um nicht den eigenen Vorurteilen ins Netz zu gehen.
Diese Anordnung strukturiert alle Kapitel: Jeweils drei Vorträge zu einem vorgegebenen Thema nähern sich ihrem Gegenstand aus wachsender Distanz. Ein jüngerer Referent hält den einleitenden Vortrag, ein älterer Kollege antwortet auf seine Thesen. Ein Dritter, der kein Fachmann für jüdische Geschichte ist und zumeist auch kein Jude, kommentiert seine beiden Vorgänger.
Die amerikanische Judaistin Susannah Heschel befreit in ihrer Gegenüberstellung von jüdischer Geschichte und Frauengeschichte die Jüdinnen aus dem feministischen Muster von Opfern und Heldinnen, Paula Hyman von der Yale University zeigt die theoretischen Grenzen der Gender-Studien auf, und Ute Frevert gibt einen historischen Überblick zur Geschlechtergeschichte.
Im Kapitel "Zionismus und Nationalismus" stellt Amnon Raz-Krakotzkin aus Beerschewa eine provokante These der Schule vor, die man in Israel die Neuen Historiker nennt. Er zeigt, wie die zionistische Historiographie systematisch alle nichtjüdischen Aspekte der Landesgeschichte ausgeblendet hat. Dan Diner aus Jerusalem fügt hinzu, daß das nationale Selbstverständnis der Juden nicht im emanzipatorischen Westen, sondern im traditionelleren Osteuropa entstanden ist; und daß sich in diesem Geschichtsbild bis auf den heutigen Tag sakrale und säkulare Elemente die Waage halten. Als Dritter erweitert der Soziologe Rogers Brubaker aus Los Angeles wieder den Rahmen und gibt zu bedenken, daß sich in allen Nationalgeschichten sakrale Mythen finden.
Am Thema des Zionismus wird deutlich, wie schwierig es ist, die "jüdische" Geschichte auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Ursprünglich hatte das sakrale Selbstverständnis der Juden ihre Rückkehr aus dem Exil auf messianische Zeiten verschoben. Erst mit dem Holocaust und der bald darauf folgenden Staatsgründung hatte man diese Vorbedingung aufgegeben - aber sind die Israelis und die Juden in der Diaspora noch immer miteinander identisch, gehören sie zu der gleichen "Nation"? Kompliziert wird die Frage durch die Tatsache, daß es im Judenstaat eine große nichtjüdische Minderheit gibt (von den besetzten Gebieten ganz zu schweigen). Nicht nur das Geschichtsbild der Juden, sondern auch ihre Identität ist gespaltener denn je.
Im Kapitel "Ideologie und Objektivität" zweifelt Michael Brenner aus München an der Möglichkeit, heute die Geschichte der Juden zu schreiben, wie es noch im neunzehnten Jahrhundert, der Blütezeit der Nationalgeschichten, Heinrich Graetz versucht hat. Seine Nachfolger Simon Dubnow und Salo Baron sind mit ähnlichen Projekten bald in Schwierigkeiten geraten, und an einer Reihe innerjüdischer Kontroversen zeigt Brenner den Verlust eines Meisternarrativs für unsere Gegenwart auf. Michael A. Meyer aus Cincinnati pflichtet ihm bei und spitzt die Dichotomien auf die Unvereinbarkeit von israelischer und jüdischer Geschichte zu. George G. Iggers aus New York rundet die Diskussion ab, indem er nach einer nicht mehr rekonstruierbaren Identität fragt, ohne die es keine Geschichte geben kann.
Das Kapitel ist aufschlußreich, da Meyer und Brenner vor einigen Jahren ihren eigenen Versuch eines Meisternarrativs unternommen haben - als Herausgeber und Mitautoren einer von einem internationalen Forscherteam geschriebenen vierbändigen Geschichte des deutschen Judentums (F.A.Z. vom 12. Februar 1997). Die Erfahrungen damit sind zweifellos in ihre gegenwärtige Skepsis eingegangen und führen zum entscheidenden Schnittpunkt des Bandes: zum Gegensatz von Moderne und Postmoderne. Mit dem Eintritt der Juden in die deutsche Kultur begann, was die Tel Aviver Historikerin Shulamit Volkov das jüdische Projekt der Moderne genannt hat; mit dem katastrophalen Scheitern ihrer Akkulturation sind auch die Prämissen dieses Projektes untergegangen - im Sinnverlust der Postmoderne.
Im Kapitel "Geschichte und Gedächtnis" stellt David N. Myers die Behauptung auf, erst in jüngster Zeit sei die Selbstreflexion zu einem Werkzeug des jüdischen Historikers geworden. Diesen Wandel begründet er mit dem "linguistic turn", den die Geschichtswissenschaft genommen habe: Man unterscheide heute zwischen den Ereignissen der Vergangenheit und dem Text, den der Historiker über sie schreibe; zuletzt erwachse dieser Text nicht aus den scheinbar objektiven Tatsachen der Vergangenheit, sondern aus der Subjektivität des Schreibenden. Auch das neue Interesse an der Geschichte der jüdischen Historiographie stamme aus diesem Zwiespalt, und die Forscher würden sich in wachsendem Maße der Zeitgebundenheit ihres Standpunkts bewußt. Als Zeugen nennt er Yosef Hayim Yerushalmi aus New York, dessen berühmtes Buch Zachor die Epoche der Selbstreflexion mit eingeleitet habe.
In seiner Antwort läßt Yerushalmi sich freilich nicht als ein Vorläufer der Postmoderne vereinnahmen. Ihrem "linguistic turn" steht er skeptisch gegenüber, und er glaubt noch immer an die objektive Überprüfbarkeit historischer Quellen. Daß man sich erst jetzt mit der Geschichte der jüdischen Historiographie befasse, liege an der Tatsache, daß sie eine noch verhältnismäßig junge Disziplin sei.
Yerushalmi mag es nicht so sehen, aber es ist ein Generationskonflikt jüdischer Historiker, den wir hier vor uns haben. In dieser Situation macht der dritte Referent - Jan Assmann, Ägyptologe und Nichtjude - das Beste aus seiner Situation: Er hält sich aus dem Streit heraus. Assmann stellt fest, daß jüdische Geschichtsschreibung nicht erst seit der Krise der Moderne, sondern schon seit den Tagen des Deuteronomiums ihren Ursprung in Katastrophenerfahrungen hat; und dann geht er auch in anderen Kulturen der Antike, in Ägypten und Mesopotamien, der Verknüpfung von Historiographie und Diskontinuität nach.
Die Tagung fand in englischer Sprache statt, und das letzte Kapitel - "Der Holocaust und historisches Denken" - zeigt an, warum es gut war, die Diskussionen ins Deutsche zu übersetzen. Yfaat Weiß aus Haifa klagt die von der Historikerzunft oft zurückgewiesene Zeugenschaft der Opfer ein, Ulrich Herbert aus Freiburg beharrt auf seiner professionellen Pflicht, die deutsche Seite der Ereignisse zu erforschen. Das Schlußwort hat Saul Friedländer, dessen Briefwechsel mit Martin Broszat einst die Debatte über Opfer- und Täterperspektiven in der Holocaustforschung eingeleitet hat. Hier klingen, schreibt er, "alte Kontroversen an - scharfsinnig, klug und kraftvoll umformuliert von einer neuen Generation von Historikern." Doch die Standpunkte nähern sich nicht an, sie bleiben unlösbar verkoppelt und zugleich getrennt.
JAKOB HESSING
Michael Brenner, David N. Myers (Hrsg.): "Jüdische Geschichtsschreibung heute". Themen, Positionen, Kontroversen. Ein Schloß Elmau-Symposion. Verlag C. H. Beck, München 2002. 308 S., br., 36,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main







 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.10.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 11.10.2002