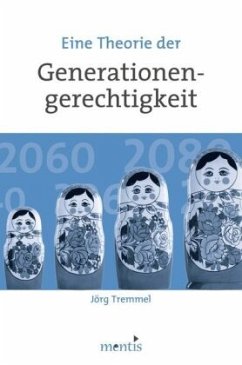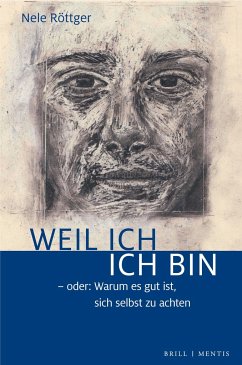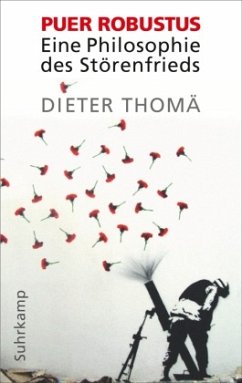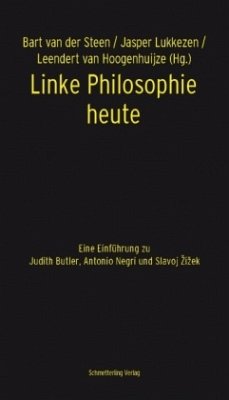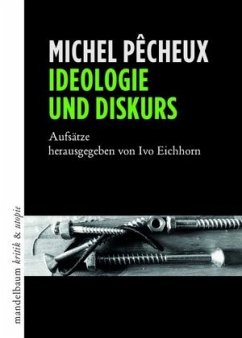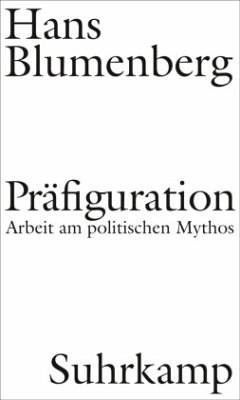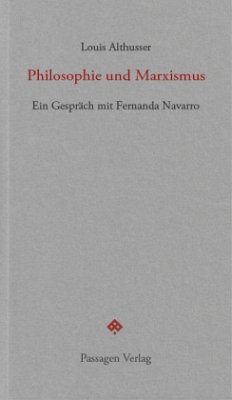Zwangsmaßnahme gemacht wird, deren Berechtigung er in Abrede stellt, kann jedenfalls nicht entscheidend sein. Anderenfalls degenerierte die Menschenwürde zur Schutzpatronin jeder individuellen Sondermoral, so abwegig diese auch sein mag.
In Betracht kommt deshalb, wie der Züricher Moralphilosoph Peter Schaber ausführt, nur ein normatives Verständnis des Instrumentalisierungsverbots. Ein anderer wird demnach dann zu einem bloßen Mittel herabgesetzt, wenn sich für die Weise, wie man mit ihm umgeht, keine guten Gründe ins Feld führen lassen, die ihm zugemutete Behandlung also moralisch unzulässig ist. Um festzustellen, ob dies der Fall ist, bedarf es Schaber zufolge einer "Theorie berechtigter moralischer Ansprüche". Den fundamentalsten dieser Ansprüche bilde der Anspruch auf Selbstachtung. "Das Selbst zu achten heißt, das Recht der Person, über wesentliche Bereiche des eigenen Lebens verfügen zu können, zu achten. Dieses Recht soll von den anderen wie auch von mir selbst geachtet werden. Es kann von anderen wie auch von mir selbst verletzt werden."
Mein Recht auf Selbstachtung hat danach also zwei Gruppen von Adressaten. Gegenüber meiner sozialen Umwelt äußert es sich als "Anspruch auf die Sicherung und Gewährleistung, die Bereitstellung und Bewahrung der Bedingungen, die es mir (und anderen) ermöglichen, das Recht auf Selbstverfügung auszuüben und von den anderen diesbezüglich geachtet zu werden". Im Hinblick auf mich selbst beinhaltet es die Forderung, für meine Ansprüche einzustehen und sie anderen gegenüber notfalls einzufordern. "Meine Würde verpflichtet mich dazu, mich selbst zu achten." Die moralischen Pflichten Dritter werden in Schabers Konzeption also ergänzt und abgerundet durch eine Pflicht des einzelnen Menschen gegen sich selbst.
Letzteres ist eine These, die in der heutigen Moralphilosophie nicht auf große Sympathie rechnen darf. Zwar lässt sich schwerlich bestreiten, dass Selbstachtung zu den wichtigsten Voraussetzungen eines guten Lebens gehört und die einzelnen moralischen Subjekte deshalb schon aus Eigeninteresse Verhaltensweisen unterlassen sollten, die ihrer Selbstachtung abträglich sind. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um ein consilium, einen guten Ratschlag, und nicht um eine Pflicht im strengen Sinne.
Schaber hingegen versteht die Pflichten gegen sich selbst in strenger Parallelität zu den Pflichten gegen andere. "Wenn die Würde des anderen mich verpflichtet, dann auch meine eigene. Meine Würde hat denselben normativen Status wie die Würde anderer. Die Würde von Personen ist nichts Individuelles. Sie ist die Würde von Personen. Wenn wir bestimmte Dinge unserer eigenen Würde schulden, haben wir eine Pflicht, von der wir uns nicht entbinden können."
Diese Verselbständigung der Würde gegenüber ihrem Inhaber bleibt bei Schaber allerdings sowohl in ihrer ontologischen Struktur als auch in ihren normativen Konsequenzen bedauerlich unterbestimmt. Rigoros durchhalten lässt sie sich jedenfalls nicht. Dass ich beispielsweise aus Respekt vor der Würde des anderen dessen Lebensrecht zu achten habe, bedeutet nicht, dass ich im Umgang mit meinem eigenen Leben ebenso strengen Bindungen unterliege. Oder will Schaber ernsthaft für ein striktes moralisches Verbot von Selbsttötungen und Risikosportarten plädieren? Anfechtbar ist auch Schabers Verständnis der Pflichten Dritter. Zu den "Mitteln, die Personen brauchen, um ein Leben mit akzeptablen Optionen führen zu können", gehören laut Schaber beispielsweise das Recht, sich frei bewegen zu können, und das Recht auf Eigentum. "Sie schützen die notwendigen Bedingungen eines Lebens in Selbstachtung und insofern eines Lebens in Würde."
Bedeutet dies, dass jeder ordinäre Diebstahl und jedes nötigende Abdrängen eines anderen von der linken Fahrspur der Autobahn zugleich eine Verletzung der Würde des Betroffenen darstellt? Eine solche Auflösung des Begriffs der Würdeverletzung in jenen der gewöhnlichen Rechtsverletzung kann nicht richtig sein. Auch Schaber sieht das Problem. Deshalb löst er den Explikationszusammenhang von Würdeverletzung und Instrumentalisierungsvorwurf auf. Die zu einer bloßen Rechtsverletzung heruntergebrochene Instrumentalisierung des anderen stellt nach seiner Auffassung lediglich die notwendige, nicht aber die hinreichende Bedingung einer Würdeverletzung dar. Worin aber liegt das erforderliche Plus?
Eine überzeugende Antwort auf diese Frage findet sich bei Schaber nicht. Am Beispiel des nationalsozialistischen Terrors gegen die Juden entwickelt er zunächst eine Position, die unverkennbare Ähnlichkeit mit Hannah Arendts Formel aufweist, wonach die Menschenwürde ein "Recht auf Rechte" begründet. "Das Tun der Nazis zielte auf das Personsein der jüdischen Bürgerinnen und Bürger. Es ging ihnen nicht darum, gewisse Interessen ihrer Opfer zu verletzen. Es ging ihnen vielmehr darum, sie als Wesen vorzuführen, die kein Recht haben, über wesentliche Bereiche ihres Lebens zu verfügen. Das ist schlimmer als jegliche Interessenverletzung."
Dies würde freilich bedeuten, dass die Menschenwürde lediglich von totalitären Unrechtsregimen verletzt werden kann. Möglicherweise ist diese Enge der Grund dafür, dass Schaber an einer späteren Stelle sein ursprüngliches Kriterium stillschweigend durch ein anderes ersetzt. Nunmehr soll es die "Verachtung dem Opfer gegenüber" sein, "die das, was wir tun, zu einer Würdeverletzung macht". Dies läuft indes auf eine einseitige Belastung des Sadisten und eine Privilegierung des gleichmütig-distanzierten Bürokraten hinaus und kann deshalb ebenfalls schwerlich als des Rätsels Lösung gelten.Insgesamt lässt Schabers Buch den Leser in zentralen Fragen des Themas also unbefriedigt zurück.
Statt der eingangs versprochenen Erfassung und Begründung des Zusammenhangs von Instrumentalisierung und Würde liefert der Autor allenfalls Bruchstücke einer philosophischen Theorie dieser Begriffe.
MICHAEL PAWLIK
Peter Schaber: "Instrumentalisierung und Würde".
mentis Verlag, Paderborn 2010. 171 S., br., 16,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
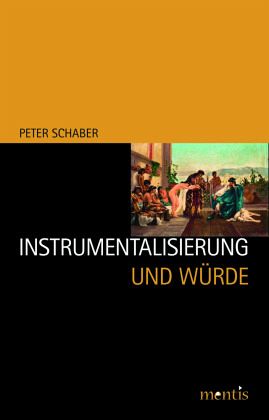




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.12.2011
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.12.2011