es insbesondere um die Konsequenzen für die Etablierung des Politikfelds der "Inneren Sicherheit".
Der Autor möchte herausfinden, welche Inhalte, Strukturen und Akteure das staatliche Handeln im "Deutschen Herbst" bestimmten und welchen Veränderungen dieses Handeln durch die Terrorismusbekämpfung unterworfen war. Dabei geht es ihm auch um die historischen Tiefendimensionen des deutschen Staatsverständnisses, das durch den Anschluss der Bundesrepublik an die politische Kultur des Westens in den fünfziger und sechziger Jahren einen nachhaltigen Wandel durchmachte. "Die bundesdeutsche Gesellschaft musste lernen, auch die härtesten Konfliktfälle nach westlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien zu regulieren, ohne in autoritäre und etatistisch fixierte Reaktionsmuster zu verfallen, die ihnen [sic!] von vielen, nicht nur der RAF vorgeworfen wurden und die als Schatten der nationalen Vergangenheit stets präsent waren."
In der Arbeit werden keine zentrale Fragestellung oder strukturierenden Erkenntnisinteressen formuliert, dafür aber eine Reihe von ungeordneten und nicht systematisch entfalteten Ober-, Unter- und Neben-Thesen. Zu diesen gehört beispielsweise die Feststellung, dass sich die Idee der staatlichen Autonomie als Ziel des "traditionellen deutschen Staatsdenkens" im Zuge der terroristischen Bedrohung aufgelöst habe. Die Interdependenz gesellschaftlicher und staatlicher Institutionen wird hier als sensationelle Erkenntnis präsentiert - genauso wie die Tatsache, dass die Bundesrepublik bei der Bekämpfung des Terrorismus auf die Zusammenarbeit mit ihren westlichen Nachbarstaaten angewiesen war (so als ob das nationalstaatliche Paradigma durch die Integration der Bundesrepublik in die EG und Nato in den siebziger Jahren noch nicht überwunden gewesen wäre).
Aus heutiger Sicht ist es durchaus bemerkenswert, dass die freiheitlichen und rechtsstaatlichen Prinzipien durch die Bekämpfung des RAF-Terrorismus zwar gelegentlich strapaziert, aber dennoch nicht überschritten wurden. Dass der Rechtsstaat erst im Zuge seiner existenziellen Bedrohung "laufen lernte", wie der Autor glauben machen will, und sich erst im Zeichen der Krise ein "in der Praxis erprobter Verfassungspatriotismus entwickelte", ist eine Schimäre. Fragwürdig ist auch die Feststellung, dass der Staat seit den siebziger Jahren den existenziellen Sicherheitsaspekten unbedingte Priorität eingeräumt und "andere Zuständigkeiten kapazitätsbedingt und aus qualitativen Wettbewerbsgründen" darüber vernachlässigt habe. Schaut man sich die Entwicklung und den Ausbau des Sozialstaates an, erscheint das nicht gerade plausibel.
Eine systematische Darstellung der Rolle, die einzelne Personen und die Beteiligten der sogenannten "Krisenstäbe" in der Terrorismusbekämpfung gespielt haben, sucht man in dem Buch vergebens. Eine solche Darstellung hätte auch ein Licht auf die durchaus unterschiedliche verfassungs- und rechtsstaatliche Prinzipienfestigkeit werfen können, die damals die Akteure auszeichnete. Manch einer von ihnen kann froh sein, dass der Verlauf der Beratungen nicht protokolliert wurde. Unterbelichtet bleibt der maßgebliche Anteil von Kanzler Helmut Schmidt (SPD) und BKA-Präsident Horst Herold an der Entscheidungsfindung. Der Autor reiht beide in eine Gruppe von insgesamt sieben Hauptentscheidungsträgern ein, denen sich weitere Personen als "Nebendarsteller" hinzugesellen.
Das Buch hätte auch Gelegenheit geboten, mit dem von den handelnden Hauptpersonen selbst gerne gepflegten Mythos aufzuräumen, wonach es ihre persönlichen Kriegserlebnisse und das Trauma der untergegangenen Weimarer Republik waren, die sie zur entschiedenen Verteidigung des freiheitlich-demokratischen Staates gegen die terroristische Bedrohung veranlassten. Tatsächlich war ihr Handeln aber in erster Linie Ausdruck einer rationalen Reaktion, die es gebot, einer verbrecherischen Erpressung nicht noch einmal nachzugeben. Dem "Deutschen Herbst" des Jahres 1977 vorausgegangen war ja zwei Jahre zuvor die Entführung des Berliner CDU-Politikers Peter Lorenz, als der Staat genau diesen Fehler - wie Helmut Schmidt später freimütig einräumte - gemacht hatte.
Stephan Scheiper hat eine immense Fülle von Material gesichtet und in seiner Arbeit unterzubringen versucht. Ein systematisch argumentierendes und gut lesbares Buch ist dabei nicht herausgekommen. Symptomatisch dafür ist, dass der Autor sich bereits in der Einleitung in seiner eigenen Gliederung verheddert. Darüber hinaus lassen zahlreiche falsche Daten und orthographische Fehler Zweifel an der handwerklichen Sorgfalt aufkommen. Wer sich über die Reaktionen des deutschen Staates auf die terroristische Bedrohung in den siebziger Jahren informieren will, dem bietet das Werk in erster Linie eine Menge Stoff - wirklich überzeugende und weiterführende Einsichten findet man darin nicht.
FRANK DECKER.
Stephan Scheiper: Innere Sicherheit. Politische Anti-Terror-Konzepte in der Bundesrepublik Deutschland während der 1970er Jahre. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 2010. 452 S., 48,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
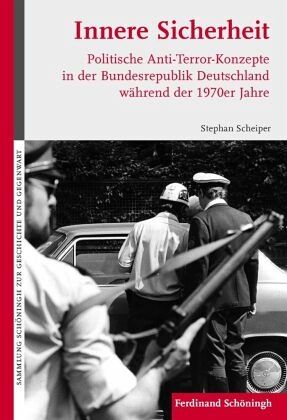




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.11.2010
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 08.11.2010