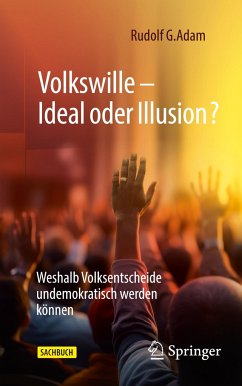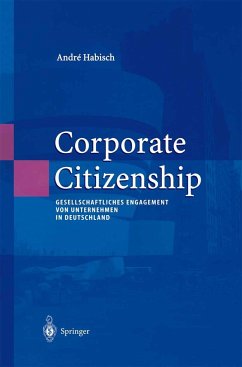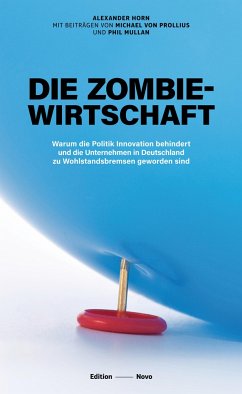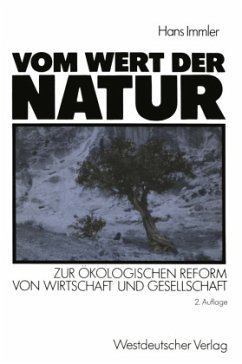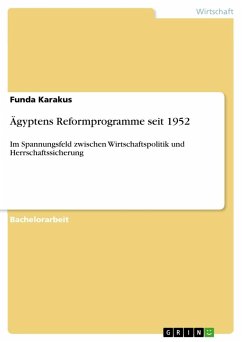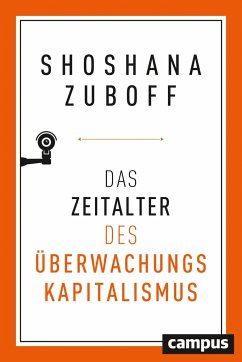gleich gut vertragen. John Stuart Mills Auseinandersetzung mit Tocqueville scheint diese Form der Darstellung schlechter zu bekommen als seinen Werken zur Freiheit oder zur Politischen Ökonomie.
Der Brite John Stuart Mill ist ein bedeutender Freiheitsphilosoph und Politischer Ökonom des 19. Jahrhunderts. Die Darstellung seiner Argumente und Ideen ist in zwei Teile, Mehrheit und Individualität, und mehrere Abschnitte gegliedert: das Joch der öffentlichen Meinung, Mehrheit und Terror, Despotie und Demokratie, Gemeinschaft und Sozialismus, Freiheit und Bildung, Individualität-Originalität-Genie, Abhängigkeit der Frau und Religion. Der Herausgeber Peer-Robin Paulus hat sich bei der Auswahl von dem Bemühen leiten lassen, die Aktualität Mills für die Probleme unserer Zeit in den Vordergrund zu rücken.
Die Freiheit des Individuums ist für Mill nicht nur ein Grundrecht auf Selbstbestimmung, sondern mindestens ebenso sehr eine Verpflichtung zur Entwicklung seines Verstandes und seiner Persönlichkeit. In dieser Beziehung steht Mill Wilhelm von Humboldt sehr nahe. Die Gesellschaft tut gut daran, den Individuen das Recht zur Selbstentfaltung zuzugestehen, denn nur der ständige Kampf um eigene und unabhängige Urteilsbildung, kann die Verzwergung der Menschen und den kulturellen Niedergang, den Verfall ganzer Zivilisationen, verhindern. Deshalb sieht Mill im Konformitätsdruck zeitgenössischer Gesellschaften ein ganz großes Übel. Selbst Exzentrität oder eigensinniges Beharren auf Irrtümern sind damit nicht vergleichbar, denn der eigensinnig Irrende fordert den Vertreter der Wahrheit immer noch zur Begründung seines Urteils heraus. Konformität aber ist auch durch Abschalten der eigenen Vernunft erreichbar. Damit wird jeder Beitrag zum Fortschritt undenkbar.
Mill ist zwar ein Vertreter und Verteidiger der demokratischen Regierungsform und lehnt Diktatur und Tyrannei ab, denn die würden nicht zu seinem Freiheitsideal passen. Aber er sieht auch die Gefahren der Demokratie sowie einer Gesellschaft, die sich dem Gleichheitsideal nähert. Stärker hierarchisch geschichteten Gesellschaften gesteht er immerhin zu, dass sie wenigstens den Angehörigen der privilegierten Schichten den Widerstand gegen die öffentliche Meinung und den Konformitätsdruck erleichtert haben. Man könnte auch sagen, dass die Demokratie von den Menschen mehr verlangt als Regierungsformen, deren zentrales Gebot die Unterwerfung ist. Deshalb scheut Mill auch weder vor dem Gedanken zurück, dass ein Volk nicht reif für die Demokratie sein könnte, noch vor dem Gedanken, dass vielleicht nicht jeder das Wahlrecht haben sollte. Ein in Zeiten der Massenzuwanderung wichtiger Gedanke Mills, sein Hinweis auf ethnische oder kulturelle Homogenität als Voraussetzung für die Demokratie, findet sich in dem Brevier allerdings nicht. Hier könnte gelten, was Paulus in anderem Zusammenhang anmerkt, dass Mill manchmal seiner Zeit voraus war.
Mill ist nicht nur ein hervorragender Freiheitsphilosoph, sondern auch ein Politischer Ökonom, der im 19. Jahrhundert das Wissen über die Politische Ökonomie so zusammenfassen wollte, wie es ein Jahrhundert davor Adam Smith getan hat. Da zeigt sich Mill recht offen für Sozialismus oder Kommunismus. Den Vorwurf der Undurchführbarkeit weist er zurück. Er hofft auf ein höheres Ausmaß an Gemeinsinn und Altruismus, den er an anderer Stelle zu einem wesentlichen Erziehungsziel erhebt. Zugegeben ist es unfair, Mill seine Unkenntnis der später entwickelten Argumente eines Mises oder Hayek oder der Entwicklung des real existierenden Sozialismus mit über 100 Millionen Menschenopfern vorzuwerfen, aber dass er die Gefahren der anderswo von ihm zu Recht befürchteten Zentralisierung der Entscheidungsgewalt als notwendige Begleiterscheinung des Sozialismus oder Kommunismus, deren Inkompatibilität mit seinem Freiheitsideal, nicht gesehen hat, das ist schon erstaunlich.
Bei seiner Behandlung des Bildungswesens ist er allerdings freiheitlicher als die Realität in den meisten westlichen Gesellschaften. Er fordert zwar staatliche Finanzierung der Bildung und Ausbildung für alle, deren Eltern das nicht leisten können, lehnt aber die fast überall herrschende Dominanz staatlicher Bildungsanstalten ab. Da hat er zumindest in groben Zügen Milton Friedman um ein Jahrhundert vorweggenommen.
Das Brevier zeigt mit Mill einen Denker, der über eine ungeheure Bandbreite der Interessen verfügt. Mit zunehmender Bandbreite entstehen leicht Spannungsverhältnisse zwischen Argumenten, die sich - jedenfalls auf den ersten Blick - mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Mill lehnt eine nur an Interessen orientierte Außenpolitik ab, sieht aber offenbar nicht, dass die Übertragung humanitärer Aufgaben jenseits der eigenen Grenzen eine Ausweitung der Staatstätigkeit erfordert und nicht gut zu seinem Ideal der Ermächtigung des Individuums statt des Staates passt.
Das Brevier zeigt, dass Mill ein bedeutsamer Freiheitsdenker ist, aber kein ebenso bedeutender Politischer Ökonom. Mit der Länge der ausgewählten Textbeiträge zur Freiheit und zur Politischen Ökonomie hat der Herausgeber Paulus das zum Ausdruck gebracht. Mill ist mit seiner Analyse der Gefahren von gesellschaftlichem Druck und einer intoleranten öffentlichen Meinung hoch aktuell.
ERICH WEEDE
Peer-Robin Paulus (Hrsg.): Individualität und Mehrheit. Ein John-Stuart-Mill-Brevier. Zürich: NZZ Libro, 208 Seiten, 24 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
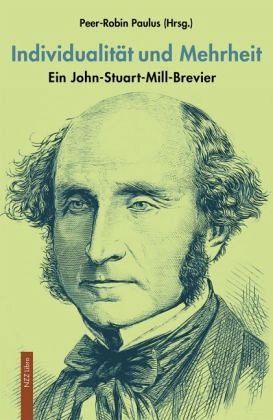




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.2017
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 09.10.2017