"Glister" erzählen in einem Akt von im wahrsten Sinne des Wortes ungeheuerlicher Meisterschaft beides zugleich: die Befreiung aus der Hölle und ihren endgültigen Sieg, den Übergang ins Licht und einen grauenvollen Foltermord. Jeder Leser muss sich entscheiden, wie er die Geschichte deutet. Aber das Wissen, dass es neben der gewählten Lesart immer noch eine zweite gibt, erzeugt ein Gefühl der Verstörung, das man nicht leicht überwindet.
Das klassische Vorbild für diese Technik der doppelten Konstruktion ist Henry James' "Turn of the Screw", eine Geistergeschichte, die man auch als Psychogramm zweier in emotionaler Kälte aufgezogener Kinder und ihrer überforderten Gouvernante auffassen kann: eine Spuknovelle und zugleich die Studie eines fortschreitenden Wirklichkeitsverlustes. Der Roman "In hellen Sommernächten" ist in Thema und Komposition eine Antwort auf den Klassiker von Henry James. In Burnsides Version spricht nun nicht die Gouvernante, es spricht das geistersehende Kind selbst, und statt zwei Lesarten stehen mindestens vier gleichberechtigt nebeneinander.
Die höchst unzuverlässige Erzählerin des Romans ist das Mädchen Liv. Ihre Mutter, eine berühmte norwegische Landschaftsmalerin, ist vor Jahren mit ihr auf die einsame Insel Kvaløya gezogen. Während die Mutter sich in der Abgeschiedenheit ganz ihrer Kunst widmet, wächst Liv sich selbst überlassen heran. Als sie erfährt, dass zwei Brüder aus ihrer Dorfschulklasse unabhängig voneinander unter rätselhaften Umständen ertrunken sind, wächst in ihr, genährt von alten Legenden, der Verdacht, eine Huldra könnte hinter den beiden Toden stecken. Eine Huldra ist ein böser Geist, der die Gestalt einer schönen Frau annehmen kann, wenn man allerdings hinter sie blickt, wird die Illusion durchscheinend; auf dem Rücken der Huldra ist ein Riss im Gefüge der Welt, eine Stelle reinen Nichts. Liv meint die Huldra in Maia wiederzuerkennen, einer Mitschülerin, in deren Gesellschaft sie die beiden Brüder kurz vor deren Tod mehrmals gesehen hat.
Der Besuch eines amerikanischen Kunstjournalisten reißt Livs Mutter für kurze Zeit aus der Isolation - ein Ereignis, das Liv zutiefst verwirrt -, und in ein leerstehendes Haus in der Nähe zieht ein neuer Bewohner namens Martin Crosbie ein, auf dessen Computerfestplatte sich, wie Liv bei einem Einbruch entdeckt, Fotos minderjähriger Mädchen finden, darunter auch solche von ihr selbst. Martin erscheint Liv als ein ideales Opfer für die Huldra, und tatsächlich beobachtet sie ihn bald schon Hand in Hand mit der unheimlichen Maia.
Liv wird ins verregnete England ans Sterbebett ihres entfremdeten Vaters gerufen. Auf der Reise kommt sie sich zunehmend selbst abhanden, fühlt sich verfolgt, hat Angstvisionen und erhält einen kryptischen anonymen Drohbrief. Nach Kvaløya zurückgekehrt, wird sie Zeugin des Verschwindens von Martin Crosbie. Liv, die nun zu viel weiß, erwartet, dass die Huldra sich als Nächstes ihr zuwenden wird.
"In hellen Sommernächten" hat, bis hin zu der finalen Konfrontation zwischen Liv und der Huldra, alles, was die Konvention von einer guten Spukgeschichte verlangt. Und doch ist der Roman nichts weniger als eine konventionelle Spukgeschichte. Der Anfang schon kündigt uns genau an, was passieren wird: Zwei Jungen ertrinken, zwei Männer verschwinden. Und am Ende, als genau das geschehen ist, gibt es statt einer Auflösung nur eine Vielzahl ineinander verschlungener Geschichten, die im Grunde alle unterschiedliche Lesarten ein und derselben Geschichte sind. Eine davon erzählt von einem Mädchen und seinem verzweifelten Kampf mit einer Todesfee, eine andere Geschichte von einem verwirrten Mädchen, das sich selbst spaltet und als Huldra eine Reihe von mörderischen Dramen in Szene setzt. Wieder eine andere Geschichte handelt von einer Psychotikerin, die sich die Huldra ebenso erträumt wie deren Verbrechen; in dieser Geschichte ist dann niemand ertrunken, und von den beiden verschwundenen Nachbarn ist der eine vermutlich einfach abgereist, und den anderen hat es nie gegeben.
"In hellen Sommernächten" ist ein Roman der falschen Fährten. Bald schon fasst man den Verdacht, dass Liv und Maia ein und dieselbe Person sind - man muss dafür nicht "Mulholland Drive" gesehen haben, jenen Film von Burnsides Seelenverwandten David Lynch, in dem ebenfalls zwei Frauen am Höhepunkt des Grauens entdecken, dass die eine der Traum der anderen ist (ein Motiv, das Lynch wiederum von Bergmans "Persona" übernommen haben könnte, in dem sich eine solche Identitätsverschmelzung ausgerechnet auf einer einsamen Insel ereignet).
Der Zusammenfall der Figuren, durch David Finchers "Fight Club" auch in die Popkultur eingegangen, ist allerdings nur eines der vielen Motive des Romans und nicht, wie in Finchers Film, die überraschende Schlusswendung. Liv selbst spielt früh mit der Idee, dass sie selbst die Huldra sein könnte und Maia bloß eine Projektion. Aber auch das ist nicht die letzte Wahrheit, sondern nur eine von vielen einander widersprechenden Möglichkeiten, bei deren Entschlüsselung man zu keinem Ende kommt; und dennoch kann man nicht aufhören, diese Entschlüsselung zu versuchen.
Letztendlich findet man sich zurückgeworfen auf das, was schon die ganze Zeit über das wohlverborgene Hauptthema war: das Verhältnis von Liv und ihrer Mutter. Ohne dieses Gravitationszentrum wäre "In hellen Sommernächten" wohl nur ein interessantes Experiment, eine faszinierende Übung in geschickter Lesertäuschung. Allen Varianten gemeinsam ist jedoch, dass es letztlich immer um ein traumatisiertes Kind geht, aufgezogen von einer lieblosen Mutter, das sich aus der seelischen Verödung nicht mehr befreien kann. Der Leser braucht eine Weile, um durch Livs bewundernde Schilderungen hindurch die Wahrheit zu begreifen: Ein Mädchen, das nie etwas anderes erlebt hat als Kälte, erfindet sich seine Mutter neu als sanft introvertierte, nur leicht zerstreute und ganz ihrer Arbeit hingegebene große Künstlerin.
So lässt sich "In hellen Sommernächten" auch als exakt komponiertes Gegenbuch zu "Glister" lesen. Dort eine sterbende Industriestadt inmitten verpesteter Umwelt, hier die unberührte Natur des hohen Nordens; dort die scheinbar realistische Geschichte eines klugen und einsamen Jungen, hinter der sich aber ein theologisches Höllengemälde verbirgt; hier ein Geisterstück, das eigentlich das sehr genau gezeichnete Psychogramm eines einsamen, klugen Mädchens ist.
Die beiden komplementären Romane durchströmt jedoch die gleiche Kraft der Formulierung. John Burnside, der über die Lyrik zum Romanschreiben gekommen ist, bleibt auch als Prosaist ein Sprachschöpfer von einzigartigem Rang, und auf fast jeder Seite finden sich Naturschilderungen, die in der Gegenwartsliteratur kaum ihresgleichen haben. Dass nun einer der am schwersten zu übersetzenden englischen Autoren in einem federnd leichten, eleganten und dem Original völlig adäquaten Deutsch vorliegt, dass seine mäandernden Sätze nie verkürzt werden und dennoch klar und verständlich bleiben, ist ein Verdienst, das man dem Übersetzer Bernhard Robben nicht hoch genug anrechnen kann.
Gewünscht hätte man sich allerdings, dass der Knaus Verlag den Titel "A Summer of Drowning" wörtlich übertragen hätte, denn schon mit ihm beginnt das Buch sein mehrdeutiges Spiel: Während man zu Beginn meint, es ginge um einen Sommer, in dessen Verlauf Menschen ertrunken sind, begreift man nach und nach, dass es eigentlich um einen Sommer geht, in dem Liv selbst in etwas, das sie nicht mehr unter Kontrolle hat, untergeht, sie erzählt ihren eigenen Sommer des Ertrinkens. "In hellen Sommernächten" dagegen ist ein Allerweltstitel, wie ihn dieser tief verstörende Roman nicht verdient hat.
Der Schriftsteller Daniel Kehlmann, geboren 1975, veröffentlichte zuletzt den Roman "Ruhm" sowie den Band "Lob: Über Literatur".
John Burnside: "In hellen Sommernächten". Roman.
Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Knaus Verlag, München 2012. 384 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
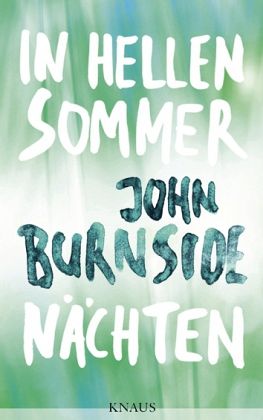





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.03.2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 10.03.2012