Phantasmagorie gequälter und von Heldenmärschen aufgepeitschter Sinnlichkeit steht am Anfang von Elizabeth Bowens siebtem Roman "In der Hitze des Tages". Während der Londoner Ausnahmezustand alle zivilen Routinen stilllegt, fördert er die animalischen Instinkte: "Ein Phänomen der Kriegsnächte in der Stadt war, dass etwas Aufreizendes in den Gang der meisten braven Frauen geriet; die Natur klopfte mit den Absätzen verbotene Signale auf den Bürgersteig." Auch Stella, Bowens Protagonistin, ist aus einer Bombennacht mit der schicksalhaften Gewissheit aufgewacht, dass sie und ihr Kollege Robert im Kriegsministerium füreinander geschaffen sind. Nichts kann ihre symbiotische Liebe erschüttern, bis sich Stella eines Tages ein Fremder mit der Nachricht nähert, dass ihr Geliebter ein Doppelleben als deutscher Spion führt.
Bowen macht aus diesem Stoff nun keinen Thriller, sondern ein Psychodrama in Prosaform. Denn Stellas Informant bietet ihr Roberts Schutz vor Verhaftung gegen Liebesdienste an. Von diesem Moment an geht es um Ambivalenzen, um Misstrauen und Verrat. Das Buch bezieht Roberts Herkunft in die Motivsuche ein. Bei einem Landausflug lernt Stella seine schrille Schwester kennen, die ihren Labrador mit den Worten einführt: "Ich denke oft, wenn Hitler diesem Hund in die Augen geschaut hätte, wäre die Geschichte vielleicht sehr anders verlaufen." Die Flure in Roberts Elternhaus führen "wie Hakenkreuzarme" ins Nichts, und im Salon hängt ein Gemälde von der untergehenden Titanic.
Stellas Geliebter entstammt einem morbiden Zuhause, in dem der verstorbene Vater seinen Sohn so zwanghaft fixierte, dass der "heute noch eine Karte mit jeder Ader in seiner Iris zeichnen" kann. Roberts Familie funktioniert wie "der Geheimdienst: Jeder wusste, wo jeder war, und rechtzeitig, was jeder vorhatte": Das beste Training für einen Agenten, der seiner verdeckten Tätigkeit dennoch in dem Bewusstsein nachgeht, sich damit endlich von seiner Erziehung zu emanzipieren.
Es ist nicht ganz leicht, in Bowens dichter Prosa eine Position auszumachen. Einerseits färbt sie Roberts Landesverrat pathologisch ein, andererseits verknüpft sie die absolute Liebe, die im Zentrum der Geschichte steht, mit schicksalhaften Bindungen und ritterlichen Werten, die Robert von der deutschen Seite verteidigt und von der westlichen Allianz gefährdet sieht. Als Veteran des Ersten Weltkriegs verzeiht er seiner Regierung Dünkirchen nicht und zählt sich zu einer Generation, die nie wirklich aus den Gräben zurückgekehrt ist: "Niemals unversehrt. Niemals im Boden verankert - und wir sind Abertausende." Es entspricht Roberts These von der entwurzelten Nation, dass Stellas Sohn aus erster Ehe ein ererbtes Landgut in Irland zum Fixpunkt seiner Existenz macht, jenem Land, das sich im Zweiten Weltkrieg neutral verhielt. Und doch ist das Gegenbild zum modernen Liberalismus für die dem Bloomsbury-Kreis nahestehende Irin Elizabeth Bowen nicht der Nationalsozialismus, sondern ein idealisiertes Feudalsystem, in dem äußere Vorrechte auf innerer Vorzüglichkeit beruhen.
In einer Nebenhandlung beschäftigt sich der Roman mit Louie, einer jungen Frau aus dem Kleinbürgertum, die eine erfrischende Neugier und die Sehnsucht nach einem Leitbild in Stellas Nähe treibt. Ihre schwärmerische Bewunderung bricht abrupt ab, als sie in der Zeitung einen Skandalartikel über Bowens Heldin liest: "Das war's dann wohl mal wieder. Punkt. Es gab niemanden zu bewundern; es gab keine Alternative."
Gleich den in künstlichem Licht hinter blinden Fenstern versteckten Stadtbewohnern ist Bowens Prosa eine des auf sich zurückgeworfenen Subjekts, das jede Begegnung mit der Außenwelt gierig aufsaugt. Jene als verloren beklagte Romantik wird in Wahrheit erst im existentiellen Klima der belagerten Metropole geboren. Die Erzählerin schwelgt in Stimmungen; ihre überempfindlichen Beschreibungen verraten eine Verwandtschaft mit Virginia Woolfs Ästhetizismus und kommen dann wieder als schwerer Symbolismus daher: "In den sich hochreckenden Baumstämmen, die sich mit den Wurzeln im Hang festklammerten, und in den sich streckenden Ästen war eine unbändige Kraft zu spüren." Stella kann sich bei diesem Ausflug in die irische Natur vorstellen, "dass die Toten aus allen Kriegen zurückkehrten". Unmittelbar darauf erfährt sie von Montgomerys entscheidendem Sieg in Ägypten: Es ist der siebte Sinn des poetischen Gemüts, den die Autorin nationalistischeren Phantasmen entgegensetzt.
Dank seiner glaubt Robert ein Rufen zu hören, als Stella sich stumm nach ihm verzehrt. Diese sensible Vernetzung mit der Umwelt leisten jenseits der Liebe nicht mehr angestammte Titel und Güter, sondern literarisch zum Ausdruck gebrachte Ahnungen und Affinitäten, jenes Wurzelwerk verfeinerter Sinne, das den animalischen Instinkt zur höchsten Kunst macht. Dass die Raffinesse der bowenschen Prosa ein Rückzugsgefecht kämpft, offenbart der ernüchternde Ausgang der Erzählung. Viele Motive schweben verwaist in der Luft, als die Logik der Handlung der Amour fou ein Ende macht. Es ist, als hätte Elizabeth Bowen die Lust an der unbändigen Natur und ihren zwischenmenschlichen Verästelungen verloren, nachdem ihrem Roman die unbändige Liebhaberfigur abhandenkam.
INGEBORG HARMS
Elizabeth Bowen: "In der Hitze des Tages". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Sigrid Ruschmer. Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2006. 440 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
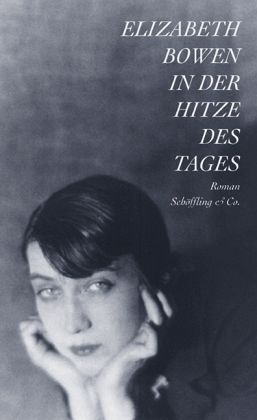




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.02.2007
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.02.2007