Nicht lieferbar
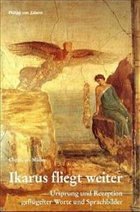
Christoph Müller
Gebundenes Buch
Ikarus fliegt weiter
Ursprung und Rezeption geflügelter Worte und Sprachbilder
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar




Tagtäglich verwenden wir wie selbstverständlich Sprachbilder, die aus der Antike (Ariadnefaden, Danaidengefäß u.s.w.) stammen - oft ohne uns dessen überhaupt bewußt zu sein (Zankapfel). Doch selbst, wenn wir noch um ihren Ursprung wissen: wer kennt noch den genauen Zusammenhang? 'Ikarus fliegt weiter ...' erklärt auf unterhaltsame Weise Ursprung und Bedeutung dieser Geflügelten Worte und Metaphern.
Produktdetails
- Kulturgeschichte der Antiken Welt Bd.76
- Verlag: WBG Philipp von Zabern
- Seitenzahl: 232
- Deutsch
- Abmessung: 22mm x 160mm x 231mm
- Gewicht: 790g
- ISBN-13: 9783805326070
- ISBN-10: 3805326076
- Artikelnr.: 09025141
Herstellerkennzeichnung
Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.11.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.11.2001Das heißt also bis nach Rom
Nach Canossa und weiter: Christoph Müllers geflügelter Wortschatz
Der Einfluß Bismarcks auf die politische Rhetorik der Deutschen ist bekannt. Als dem für den Posten des vatikanischen Botschafters vorgeschlagenen Kardinal Hohenlohe die Akkreditierung durch Papst Pius IX. verweigert wurde, sprach der Kanzler im Reichstag den denkwürdigen Satz: "Nach Canossa gehen wir nicht." Daß die Bemerkung keine Beiläufigkeit blieb, ist Georg Büchmann zu danken. Noch im gleichen Jahr nahm der Philologe und Zitatensammler das Bismarck-Wort in die Neuauflage seiner schon damals überaus erfolgreichen "Geflügelten Worte" auf. Das Nachschlagewerk erwies sich als Longseller. 1864 erstmals erschienen, hat es
Nach Canossa und weiter: Christoph Müllers geflügelter Wortschatz
Der Einfluß Bismarcks auf die politische Rhetorik der Deutschen ist bekannt. Als dem für den Posten des vatikanischen Botschafters vorgeschlagenen Kardinal Hohenlohe die Akkreditierung durch Papst Pius IX. verweigert wurde, sprach der Kanzler im Reichstag den denkwürdigen Satz: "Nach Canossa gehen wir nicht." Daß die Bemerkung keine Beiläufigkeit blieb, ist Georg Büchmann zu danken. Noch im gleichen Jahr nahm der Philologe und Zitatensammler das Bismarck-Wort in die Neuauflage seiner schon damals überaus erfolgreichen "Geflügelten Worte" auf. Das Nachschlagewerk erwies sich als Longseller. 1864 erstmals erschienen, hat es
Mehr anzeigen
inzwischen die einundvierzigste Auflage erreicht.
Doch Büchmann wollte nicht bloß dokumentieren, er wollte auch Politik machen. Ein gelungenes Beispiel für Performativität gibt der Kommentar, mit dem er 1872 seinen Neueintrag versah: "Das Kanzlerwort wird schwerlich untergehen." So klingt es, wenn ein deutscher Gelehrter seinem Herzen Luft macht. Neuere Auflagen des Büchmann begnügen sich dagegen mit dem erläuternden Hinweis, Bismarck sei tags zuvor von einer Bekannten auf die Canossaszene angesprochen worden, die sie in einem Geschichtsbuch gefunden habe. Doch die anekdotische Version ist verharmlosend. Sie verschweigt den politischen Zusammenhang, der Georg Büchmann noch klar vor Augen gestanden und der einst seinen Ersteintrag für die Zeitgenossen als Positionsbeschreibung erkennbar gemacht hatte: den Zusammenhang des gleichfalls Anfang der siebziger Jahre durch Rudolf Virchow zu seinem Begriffsnamen gekommenen "Kulturkampfes".
Nicht nur Bücher, auch Worte haben ihre Geschichte, zumal dann, wenn sie "geflügelte Worte" heißen. Der Büchmann, der sie seit knapp hundertfünfzig Jahren zusammenträgt, beschränkt sich zumeist auf die Angabe der Fundstellen und Erstbelege. Ergänzend dazu erzählt jetzt Christoph Müller rund zwei Dutzend Geschichten, in denen die Flugbahnen ausgewählter Motive exemplarisch festgehalten sind: Angefangen bei den Würfeln, die gefallen sind, über den Knoten, der durchschlagen sein will, bis hin zum Zankapfel oder "Apfel der Zwietracht", der selbst die Götter in Streit geraten läßt. Müller ordnet seine ursprünglich als Artikelserie erschienenen Motivgeschichten alphabetisch, doch dem Handbuch, das der Büchmann immer sein wollte, macht er keine Konkurrenz. Müller schreibt für Leser, und der immense Arbeitsaufwand, den seine detaillierte Bibliographie nur eben andeutet, verschwindet unter der Oberfläche einer unangestrengten, angenehm lesbaren Prosa.
Dabei sind die Gegenstände so anspruchsvoll wie komplex. Müller gibt nicht nur die Ursprungserzählungen in ihren Varianten wieder, sondern berichtet auch über Deutungsveränderungen, Forschungsdebatten, Instrumentalisierungen. Man erfährt die näheren Umstände, die während der Schreckensherrschaft in Paris zur Erfindung des "Vandalismus" führten, und daß die Vandalen selbst eher zur Zurückhaltung neigten, ja sogar der spanischen Region Andalusien zu ihrem Namen verhalfen.
Ähnlich erstaunlich verlief die Rezeptionsgeschichte des Canossagangs, dessen rhetorisches Potential gleichfalls erst die Aufklärer entdeckten und kirchenkritisch einsetzten. Einmal enthistorisiert, war das Motiv nun vielfältig verwertbar, und kam Jahrzehnte später in den Reichstag und auch wieder hinaus. Als 1886 Fontanes Roman "Cécile" erschien, fand sich darin eine mehrseitige Plauderei über das bereits legendäre Bismarck-Wort. Ohne weiteres ist die Reisegesellschaft sich einig, daß nun doch nach Canossa gegangen werde, nach Canossa und noch weiter. ",Das heißt also', ergreift ein Geheimrat Hedemeyer das Wort, ,bis nach Rom. Es sind dies die natürlichen Folgen der Prinzipienlosigkeit oder, was dasselbe sagen will, einer Politik von heut' auf morgen, des Gesetzmachens ad hoc. Ich hasse das.' Die Baronin, die sich in dieser Wendung zitiert glaubte, klatschte mit ihren zwei Zeigefingern Beifall." Schade eigentlich, daß die Allergnädigste das Werk von Müller nicht gekannt hat. Zweifellos hätte sie es in ihre vornehme Begeisterung mit einbezogen.
RALF KONERSMANN
Christoph Müller: "Ikarus fliegt weiter". Ursprung und Rezeption geflügelter Worte und Sprachbilder. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 2001. 232 S., 73 S/W-Abb., 8 Farbtaf., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Doch Büchmann wollte nicht bloß dokumentieren, er wollte auch Politik machen. Ein gelungenes Beispiel für Performativität gibt der Kommentar, mit dem er 1872 seinen Neueintrag versah: "Das Kanzlerwort wird schwerlich untergehen." So klingt es, wenn ein deutscher Gelehrter seinem Herzen Luft macht. Neuere Auflagen des Büchmann begnügen sich dagegen mit dem erläuternden Hinweis, Bismarck sei tags zuvor von einer Bekannten auf die Canossaszene angesprochen worden, die sie in einem Geschichtsbuch gefunden habe. Doch die anekdotische Version ist verharmlosend. Sie verschweigt den politischen Zusammenhang, der Georg Büchmann noch klar vor Augen gestanden und der einst seinen Ersteintrag für die Zeitgenossen als Positionsbeschreibung erkennbar gemacht hatte: den Zusammenhang des gleichfalls Anfang der siebziger Jahre durch Rudolf Virchow zu seinem Begriffsnamen gekommenen "Kulturkampfes".
Nicht nur Bücher, auch Worte haben ihre Geschichte, zumal dann, wenn sie "geflügelte Worte" heißen. Der Büchmann, der sie seit knapp hundertfünfzig Jahren zusammenträgt, beschränkt sich zumeist auf die Angabe der Fundstellen und Erstbelege. Ergänzend dazu erzählt jetzt Christoph Müller rund zwei Dutzend Geschichten, in denen die Flugbahnen ausgewählter Motive exemplarisch festgehalten sind: Angefangen bei den Würfeln, die gefallen sind, über den Knoten, der durchschlagen sein will, bis hin zum Zankapfel oder "Apfel der Zwietracht", der selbst die Götter in Streit geraten läßt. Müller ordnet seine ursprünglich als Artikelserie erschienenen Motivgeschichten alphabetisch, doch dem Handbuch, das der Büchmann immer sein wollte, macht er keine Konkurrenz. Müller schreibt für Leser, und der immense Arbeitsaufwand, den seine detaillierte Bibliographie nur eben andeutet, verschwindet unter der Oberfläche einer unangestrengten, angenehm lesbaren Prosa.
Dabei sind die Gegenstände so anspruchsvoll wie komplex. Müller gibt nicht nur die Ursprungserzählungen in ihren Varianten wieder, sondern berichtet auch über Deutungsveränderungen, Forschungsdebatten, Instrumentalisierungen. Man erfährt die näheren Umstände, die während der Schreckensherrschaft in Paris zur Erfindung des "Vandalismus" führten, und daß die Vandalen selbst eher zur Zurückhaltung neigten, ja sogar der spanischen Region Andalusien zu ihrem Namen verhalfen.
Ähnlich erstaunlich verlief die Rezeptionsgeschichte des Canossagangs, dessen rhetorisches Potential gleichfalls erst die Aufklärer entdeckten und kirchenkritisch einsetzten. Einmal enthistorisiert, war das Motiv nun vielfältig verwertbar, und kam Jahrzehnte später in den Reichstag und auch wieder hinaus. Als 1886 Fontanes Roman "Cécile" erschien, fand sich darin eine mehrseitige Plauderei über das bereits legendäre Bismarck-Wort. Ohne weiteres ist die Reisegesellschaft sich einig, daß nun doch nach Canossa gegangen werde, nach Canossa und noch weiter. ",Das heißt also', ergreift ein Geheimrat Hedemeyer das Wort, ,bis nach Rom. Es sind dies die natürlichen Folgen der Prinzipienlosigkeit oder, was dasselbe sagen will, einer Politik von heut' auf morgen, des Gesetzmachens ad hoc. Ich hasse das.' Die Baronin, die sich in dieser Wendung zitiert glaubte, klatschte mit ihren zwei Zeigefingern Beifall." Schade eigentlich, daß die Allergnädigste das Werk von Müller nicht gekannt hat. Zweifellos hätte sie es in ihre vornehme Begeisterung mit einbezogen.
RALF KONERSMANN
Christoph Müller: "Ikarus fliegt weiter". Ursprung und Rezeption geflügelter Worte und Sprachbilder. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 2001. 232 S., 73 S/W-Abb., 8 Farbtaf., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Begeistert ist Ralf Konersmann von Christoph Müllers Buch über den Ursprung und die Rezeption geflügelter Worte. Zu Georg Büchmanns Band "Geflügelte Worte", der inzwischen die einundvierzigste Auflage erreicht habe, sei Müllers Buch eine bereichernde Ergänzung, meint Konersmann, da die Ursprünge der geflügelten Worte genauer betrachtet würden. Zudem werde der Leser über "Deutungsveränderungen, Forschungsdebatten und Instrumentalisierungen" der geflügelten Worte in 24 Artikeln informiert. Müllers Buch beinhalte nicht nur eine detaillierte Bibliographie, sondern sei darüber hinaus auch noch "angenehm" zu lesen, lobt Konersmann. Wer also schon immer einmal wissen wollte, warum die Würfel gefallen sind, der wird in diesem Band fündig.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben


