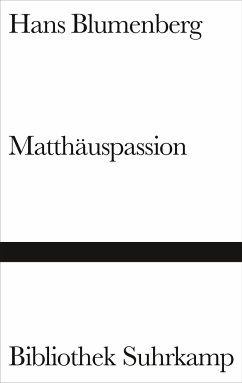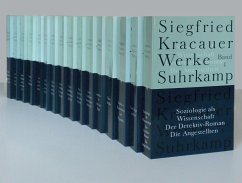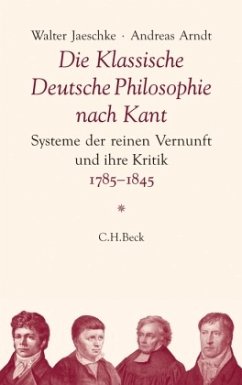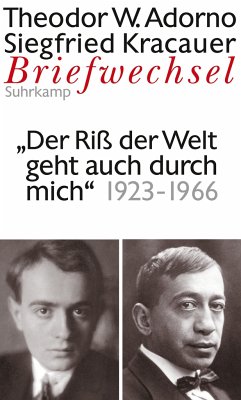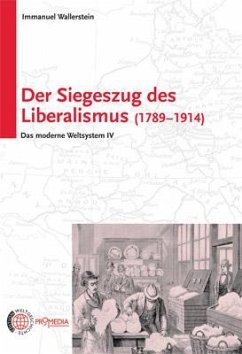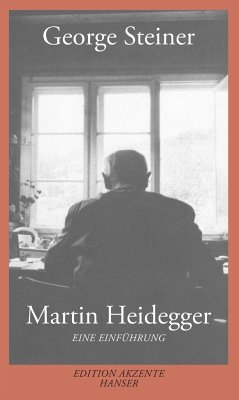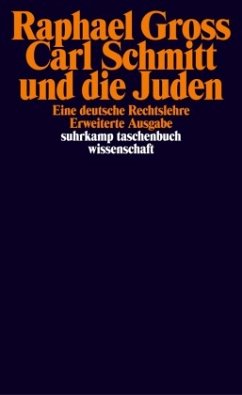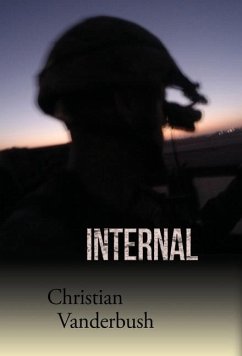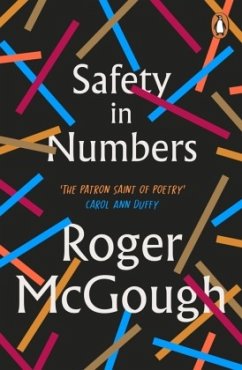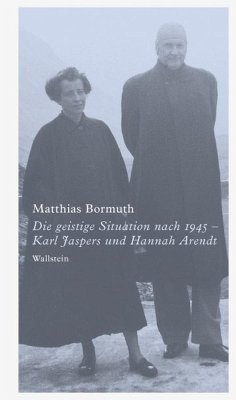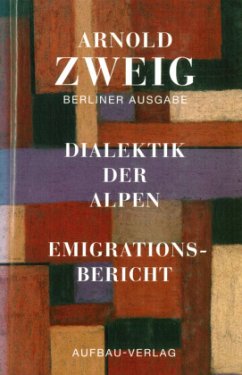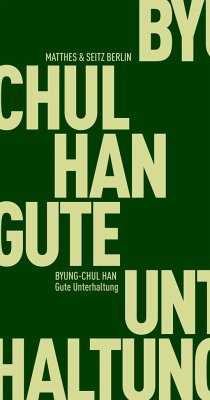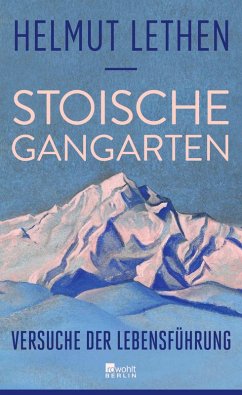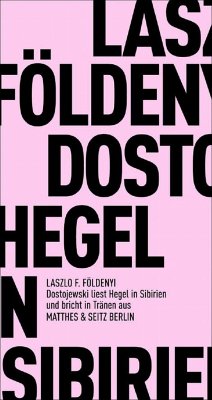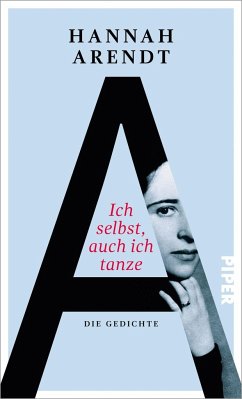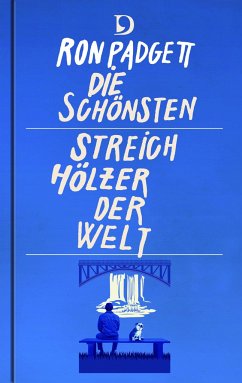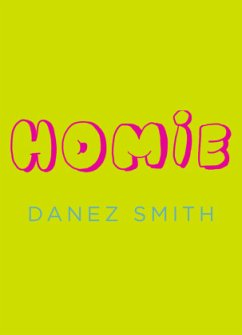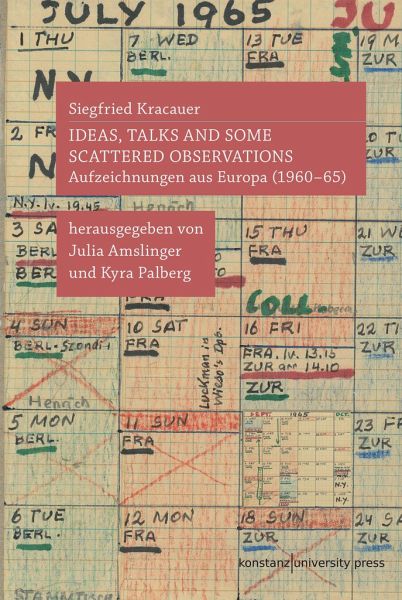
Ideas, talks and some scattered observations
Aufzeichnungen aus Europa (1960-65)
Herausgegeben: Amslinger, Julia; Palberg, Kyra
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
26,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In seinen letzten Lebensjahren reiste Siegfried Kracauer regelmäßig nach Europa und dokumentierte seinen Blick auf Orte und Personen in Heften, Notizbüchern und kurzen Texten. Die Aufzeichnungen aus Europa versammeln diese bisher unveröffentlichten Notizen, Gedankenprotokolle und Ideensammlungen in einer Auswahl, die den Zeitgeist der europäischen 1960er Jahre als offenen Erwartungshorizont erscheinen lässt.Unmittelbar nach dem Reichstagsbrand war Kracauer mit seiner Frau Lili nach Paris geflohen. 1941 gelang den beiden die Auswanderung in die USA. Sowohl seine privaten Notizen als auch ...
In seinen letzten Lebensjahren reiste Siegfried Kracauer regelmäßig nach Europa und dokumentierte seinen Blick auf Orte und Personen in Heften, Notizbüchern und kurzen Texten. Die Aufzeichnungen aus Europa versammeln diese bisher unveröffentlichten Notizen, Gedankenprotokolle und Ideensammlungen in einer Auswahl, die den Zeitgeist der europäischen 1960er Jahre als offenen Erwartungshorizont erscheinen lässt.Unmittelbar nach dem Reichstagsbrand war Kracauer mit seiner Frau Lili nach Paris geflohen. 1941 gelang den beiden die Auswanderung in die USA. Sowohl seine privaten Notizen als auch seine wissenschaftlichen Arbeiten verfasste Kracauer seit Kriegsende in einem sehr eigenen Englisch. Anders als die meisten seiner Frankfurter Freunde und Bekannten wollte er nicht nach Deutschland zurückkehren, reiste aber gleichwohl zu Beginn der 1960er Jahre quer durch Europa. Bei diesen Reisen verabredete er sich mit den bekanntesten Intellektuellen seiner Zeit zu langen Gesprächen. Nicht die zu besichtigenden Orte, sondern die dort zu treffenden Menschen bestimmten die sommerlichen Reiserouten von Lili und Siegfried Kracauer.Kracauer diskutiert mit Werner Kaegi neue Formen der Geschichtsschreibung, träumt mit Benno Lewy von einer sozialistischen Gesellschaftsordnung in Israel und fragt Gotthard Günther, ob die Menschen schon bald mithilfe von Computern den Tod besiegen werden. Kracauer protokolliert jedoch nicht nur das Gesagte, sondern ergänzt auch das Unausgesprochene: etwa wie er Theodor W. Adornos Dialektik hätte kritisieren können, es aber nicht getan hat. Das Wiedersehen mit alten Freundinnen und Freunden und auch entfernter bekannten Intellektuellen wird so als prekärer Versuch der Vermittlung zwischen Vergangenheit und Gegenwart greifbar.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.