Nicht lieferbar
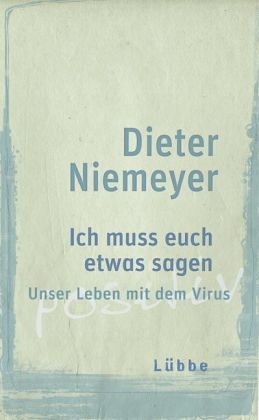
Ich muss euch etwas sagen
Unser Leben mit dem Virus
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Dieter und Almut führen ein überschaubares Leben, zwei kleine Kinder, Dieter ist Hausmann, Almut Dialyseschwester in einer Ambulanz. Der Anruf ereilt sie mitten in den Vorbereitungen zum Weihnachtsfest: Almut ist Hiv-infiziert, sagt die Blutspendezentrale. Man schreibt das Jahr 1990, Aids ist die Krankheit, der Schwule und Drogenabhängige zum Opfer fallen, die Hysterie um das Virus ist auf dem Höhepunkt.Das Ehepaar ist verzweifelt, auch Dieter ist bereits infiziert. Was erwartet sie? Gesellschaftliches Stigma, baldige Erkrankung, früher Tod? Was wird aus den Kindern? Das Paar entscheidet ...
Dieter und Almut führen ein überschaubares Leben, zwei kleine Kinder, Dieter ist Hausmann, Almut Dialyseschwester in einer Ambulanz. Der Anruf ereilt sie mitten in den Vorbereitungen zum Weihnachtsfest: Almut ist Hiv-infiziert, sagt die Blutspendezentrale. Man schreibt das Jahr 1990, Aids ist die Krankheit, der Schwule und Drogenabhängige zum Opfer fallen, die Hysterie um das Virus ist auf dem Höhepunkt.
Das Ehepaar ist verzweifelt, auch Dieter ist bereits infiziert. Was erwartet sie? Gesellschaftliches Stigma, baldige Erkrankung, früher Tod? Was wird aus den Kindern? Das Paar entscheidet sich für einen radikalen Weg, mit allen Konsequenzen: Sie schweigen. Eisern. 18 Jahre lang. Erst als beide Kinder volljährig sind, weihen sie sie ein und stellen sich kurz darauf der Öffentlichkeit.
Das Ehepaar ist verzweifelt, auch Dieter ist bereits infiziert. Was erwartet sie? Gesellschaftliches Stigma, baldige Erkrankung, früher Tod? Was wird aus den Kindern? Das Paar entscheidet sich für einen radikalen Weg, mit allen Konsequenzen: Sie schweigen. Eisern. 18 Jahre lang. Erst als beide Kinder volljährig sind, weihen sie sie ein und stellen sich kurz darauf der Öffentlichkeit.




