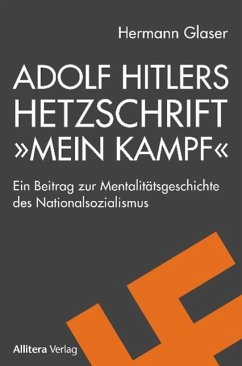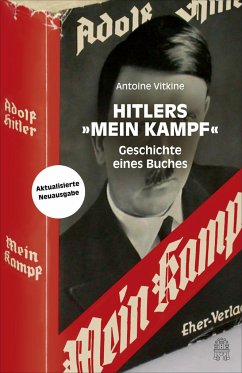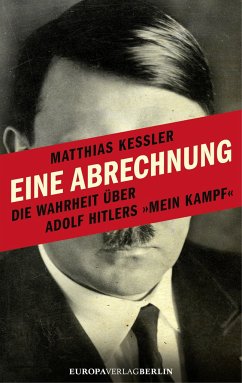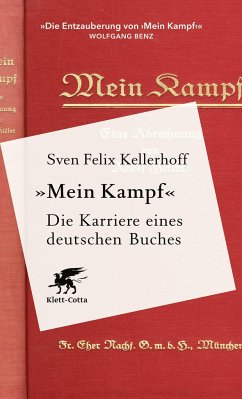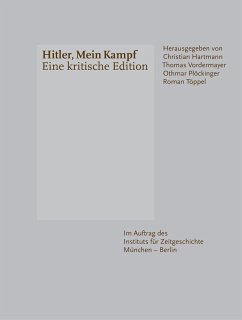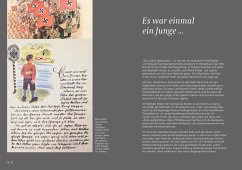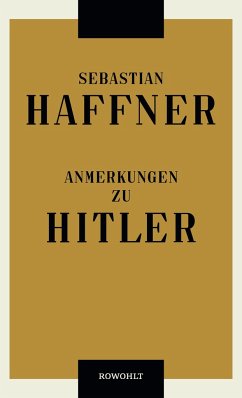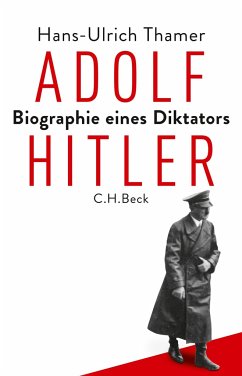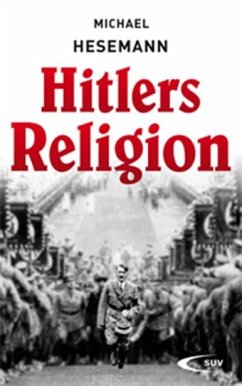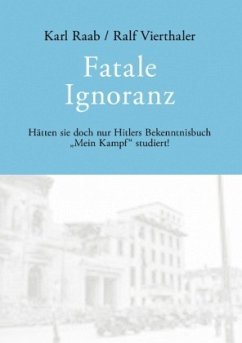früheren Formen diktatorischer Machtausübung.
Barbara Zehnpfennigs Untersuchung trägt dieser Tatsache Rechnung, weil sie Hitlers Denken noch diesseits aller praktischen Umsetzung in den Blick nimmt. Denn dieses Denken ging der Entscheidung zum Tun und Handeln ganz offensichtlich voraus. Einer funktionalistischen Sichtweise, die Hitlers programmatische Intentionen herunterspielt und dadurch seine persönliche Verantwortung für den Holocaust zugunsten anonymer Prozesse verharmlost, wird somit eine klare Absage erteilt.
Die Autorin optiert dafür, sich auf Hitlers Denkweg einzulassen und die immanenten Konsequenzen seiner Weltanschauung ernst zu nehmen. Sie liefert in Form eines quellennahen Kommentars zu Hitlers Bekenntnisschrift "Mein Kampf" nicht nur die erste philosophisch-politiktheoretische Interpretation der Inhalte und Ziele Hitlerschen Denkens, sondern die wohl überhaupt gehaltvollste Auseinandersetzung mit den Intentionen des deutschen Diktators seit den Büchern von Eberhard Jäckel (1969) und Joachim Fest (1973). Dabei werden vor allem auf dem Gebiet der vergleichenden Ideologiegeschichte neuartige Einsichten zutage gefördert.
Wie bisher niemand sonst interpretiert die Autorin Hitlers Weltanschauung konsequent als Paradigma eines Denkens, das zeit- und personenunabhängig eine Grundmöglichkeit der Haltung zur Welt bezeichnet: des ideologischen Bewußtseins, dessen hervorstechendstes Merkmal in einer selektiv verzerrten Wirklichkeitswahrnehmung liegt. Die vorgegebene Realität wird nicht in ihrem Sosein zur Kenntnis genommen, sondern von vornherein als Projektionsfläche eigener Vorstellungsinhalte mißbraucht. Diesen selbstgesetzten Vorstellungen hat die Welt sich zu fügen, statt daß - wie es richtig und für ein "normales" Bewußtsein angemessen wäre - die subjektiven Setzungen an der Realität überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.
Hitlers monströser Vernichtungsantisemitismus erscheint in dieser Perspektive als Frucht und Folge solch ideologischen Bewußtseins, das seine gesamte Welterklärungsstrategie aus einer einzigen "letzten Ursache" herleite: dem Streben des Judentums nach Zerstörung der Menschheitskultur als alleinigem Ursprung alles Bösen. Daß sich angesichts einer solchen selbstvorgenommenen Rollenzuweisung die Vernichtung des vermeintlichen Weltfeindes subjektiv als ein aus "Notwehr" geborener "Erlösungsakt" darstellt, macht das Jahrhundertverbrechen des Holocaust zwar nicht nachvollziehbarer, wirft aber ein helles Licht auf die Grundsatzfrage, wie ideologisches Denken funktioniert und was es anrichten kann.
Und dies um so mehr, als das bei Hitler geortete ideologische Denkschema in seiner prinzipiellen Fehlorientierung weitgehende Deckungsgleichheit mit entsprechenden Argumentationsmodellen des Marxismus aufweist. Auch Marx und seine sowjetischen Nachfolger lebten in der Überzeugung, mit dem "Kapitalisten" den alleinigen Verursacher der Abkehr vom "heilen" Urzustand dingfest gemacht zu haben. Und auch hier wurde die intendierte Vernichtung einer ganzen Kollektivexistenz - eben der kapitalistischen - zu einem Heilsakt im Dienst der Wiederherstellung wahren Menschseins umgelogen.
Man mag den Nachweis solch struktureller Gemeinsamkeiten zwischen rechts und links noch immer als Provokation empfinden - einfach abtun kann man ihn nach der stichhaltigen Argumentationsführung der Verfasserin nicht mehr, zumal sich ihre Forschungsergebnisse bruchlos in die Reihe neuerer Untersuchungen zur vergleichenden Totalitarismusforschung einfügen.
Schon die Bücher von François Furet (1995) und Gerd Koenen (1998) hatten deutlich gemacht, daß die Vernachlässigung entsprechender Vergleiche maßgeblich mit der Legitimation des "Antifa-Mythos" für die Aufrechterhaltung der kommunistischen Herrschaftssysteme in Osteuropa zusammenhing. Barbara Zehnpfennig präzisiert diese Untersuchungsergebnisse aus anderer Perspektive und veranschaulicht vor allem eines: Hitlers Weltanschauung war die falsche Alternative zu einem falschen Denken und zu einer falschen Praxis.
Kritik wird die Verfasserin vor allem aus methodischen Gründen auf sich ziehen. Das von ihr gewählte hermeneutische Verfahren, das historische Sachzusammenhänge ebenso vernachlässigt wie maßgebliche neuere Forschungsliteratur, zieht zur Erklärung Hitlerschen Denkens immer wieder philosophische Tradition heran. So erscheint etwa das als zentral herausgestellte Motiv des Selbstopfers als Reflex einer vermeintlich existentialistischen Haltung, die nach einer Entgrenzung des Ichs strebe und in der Erfahrung von Ausnahmesituationen eine "pervertierte Transzendenzsuche" betreibe. Es bleibt fraglich, ob solche Deutungen dem Denken des Diktators nicht ungewollt einen intellektuellen Rang zubilligen, den es tatsächlich nie besessen hat. Die Ergebnisse des Buches werden die Hitler-Forschung jedenfalls noch lange Zeit beschäftigen.
FRANK-LOTHAR KROLL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.01.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.01.2001