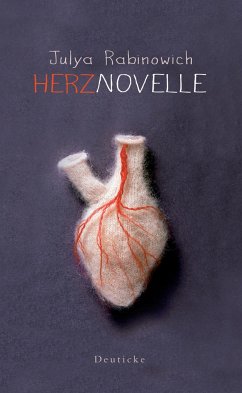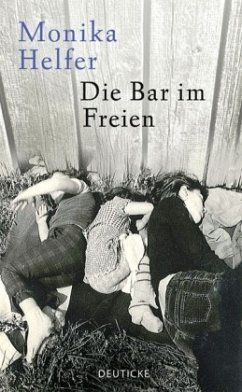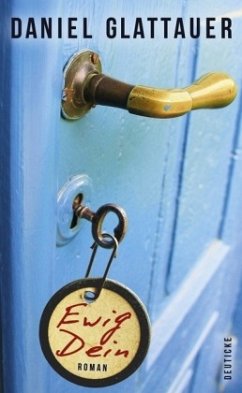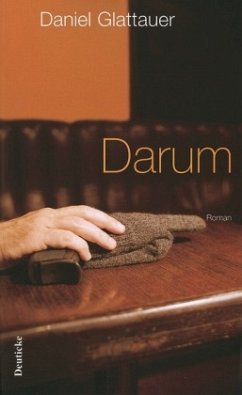droht akute Überhitzung. Das Herz, die Liebe, der Schmerz - Julya Rabinowich bringt in den ewigen Gleichklang der Literatur eine neue Note hinein, indem sie das Herz nicht nur als Symbol, sondern als Organ zum Objekt der Begierde macht. "Ich träume wieder / von seiner Hand / die in meinen Brustkorb greift", heißt es in einem der in die Erzählung eingestreuten Gedichte. Überhaupt verlaufen die Grenzen zwischen feuchten Träumen, Wunschträumen und realem Geschehen fließend: Wie weit geht die Gute wirklich beim Herrn Doktor? Die Grenzerfahrung der Herzoperation macht sie furchtlos, treibt sie dem kleinen Tod geradezu in die Arme. Staunend registriert sie selbst, wie Scham und Anstand ihre Rechte verlieren, es ist der Körper, der, einmal mit Aufmerksamkeit bedacht, die seinen rücksichtslos geltend macht.
Stilisierte EKG-Kurven markieren die Abschnitte der Novelle. Es scheint, als erobere der Ärzteroman, in ironischer Verkleidung, die hohe Literatur. Man muss deshalb nicht gleich einen Trend ausrufen, aber merkwürdig ist es schon, dass nun nach Anna-Elisabeth Mayers Ich-Erzählerin im Vorjahr ("Fliegengewicht") eine zweite junge Herzpatientin auf ihren Arzt reflektiert und Rabinowichs Verlagskollege Peter Stephan Jungk mit "Das elektrische Herz" soeben ein Pendant aus männlicher Perspektive vorgelegt hat.
Die Obsession ist in "Herznovelle" in jeder Hinsicht ungesund: Die Patientin provoziert einen Notfall, um wieder auf der Kardiologie zu landen, sie nimmt die dreifache der vorgeschriebenen Medikation, dann wieder gar nichts, um dem vergötterten Arzt, der sich vor ihr versteckt, nur ja wieder vorgeführt zu werden. Sogar in den Ärzteball schummelt sie sich, trifft dort aber nur ihren alten Hausarzt, der ihre jagdlustige Aufmachung peinlich missversteht.
Wenn eine Wiener Autorin ihre Heldin mit erotischen Phantasien ausstattet und auf einen Faschingsball schickt und die Geschichte auch noch "Herznovelle" nennt, sind Assoziationen zu Arthur Schnitzlers "Traumnovelle" offensichtlich erwünscht. Mindestens ebenso deutliche Spuren führen zu "Fräulein Else", einem Text, der nicht zuletzt von einer masochistischen Lustangst erzählt: Wie Else streift die Frau sich einen Mantel über, um sich, darunter nackt, seiner mit Aplomb zu entledigen. Ihr Adressat ist freilich ein Zwangsbeglückter. Im Gedicht beschreibt das Ich die Situation als Zweikampf, wiederum anspielend auf Schnitzlers "Duell im Morgengrauen": "Mein Begehren ist ein Gewehr / das auf jemanden gerichtet werden will." Hat dieses ziellose Begehren sein Objekt einmal aufs Korn genommen, dann gnade ihm Gott.
"Herznovelle" zeigt mit erschreckender Präzision die Innenansicht einer Stalkerin, die durchaus weiß, was sie da tut. Beschrieben wird eine Verirrung, eine Art libidinöser Haushaltsunfall. In Wahrheit aber lehrt die Geschichte, dass jedes Verliebtsein haarscharf an den Wahnsinn grenzt. Der anvisierte Medizinmann soll für eine Lücke büßen, für die er nichts kann, soll eine Wunde heilen, die er nicht geschlagen hat: "Ich will, dass Sie mich ganz machen." Der Ehemann, "zufrieden mit unserer ruhigen Paarweise", scheint ausgespielt zu haben und wird zuletzt doch noch zum zweifelhaften Joker.
Wie schon in ihrem Romandebut "Spaltkopf" (2008), das ihr den Rauriser Literaturpreis einbrachte, nähert sich die gebürtige Leningraderin den großen Gefühlen mit kleinem Gepäck, ohne Pathoslast, mit Witz und bösem Scharfblick: Das Ich sieht sich als Maschine, der "kleine Ausfälle" gestattet sind. Solange die Mahlzeiten auf dem Tisch stehen und des Gatten Geschäftsfreunde bewirtet werden. "Dazwischen darf ich verhaltensoriginell sein, in unseren vier Wänden, wenn es keiner sieht. Anschließend wird die Maschine mit viel Liebe zum Detail gewartet, und wir fahren die nächsten pannenfreien Kilometer." Rabinowichs beherzt bildreicher Stil macht die Lektüre zum Vergnügen, das durch die eingebettete Herzschmerz-Lyrik der coolen Art nicht merkbar gesteigert wird. Ein wenig fremd und manchmal redundant stehen die Verse zwischen den Prosa-Stücken herum.
DANIELA STRIGL
Julya Rabinowich: "Herznovelle".
Deuticke Verlag, Wien 2011. 158 S., geb., 15,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
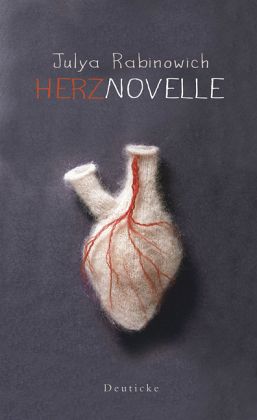





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.06.2011
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 01.06.2011