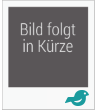Nicht lieferbar

Henriette Jacoby
Roman
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Mit dem Roman 'Henriette Jacoby' setzte Georg Hermann auf Drängen des Publikums die Geschichte Jettchen Geberts fort - die in jener windklaren, sternenhellen Novembernacht des Jahres 1839 ihrer Hochzeit den Rücken gekehrt - und die Ehe mit dem ungeliebten Mann abgebrochen hatte. Doch Henriettes mutiges Aufbegehren mündet nicht in eine harmonische Lösung des Konflikts. Auf unheilvolle Weise verliert sie sich wieder an die Familie Gebert und gerät in den Teufelskreis von Konvention und Entschlußlosigkeit. Die Tragödie neigt sich dem unausweichlichen Ende zu.