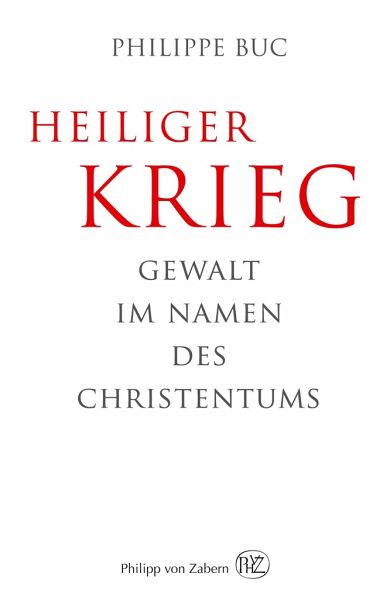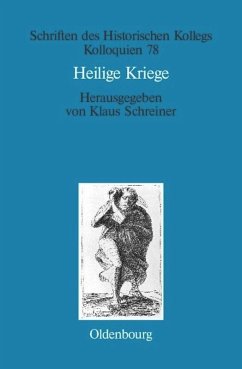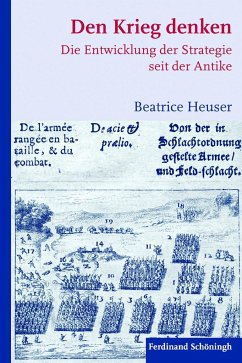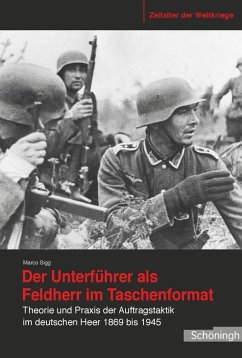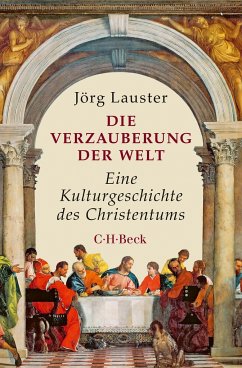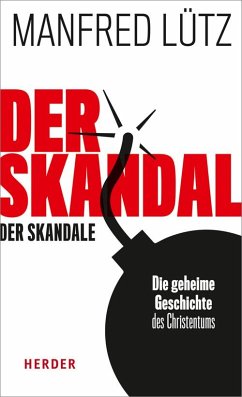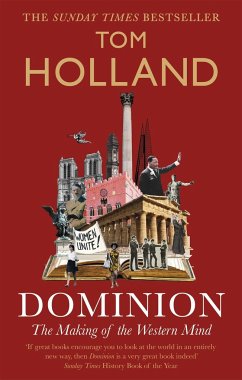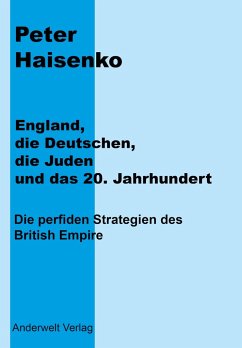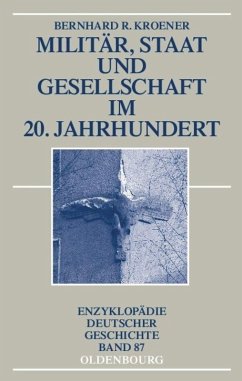»Philippe Buc hat ein anregendes [...] Buch über Themen geschrieben, an denen Voltaire seine Freude gehabt hätte.« Frankfurter Allgemeine Zeitung »Philippe Buc deckt mit großer Quellenkompetenz und ausgeprägtem Aktualitätsbezug die historischen Wurzeln des Geflechts der gegenwärtigen weltpolitischen Verwerfungen auf - ein gänzlich neuer Ansatz.« Fränkische Nachrichten »Der französische Mediävist stößt mit seiner Arbeit zentrale Fragen der Geschichtswissenschaft an und provoziert zugleich wertvolle Resonanzen.« Zeitschrift für Historische Forschung »Heiliger Krieg, Märtyrertum und Terror gehören zu den zentralen und beklemmenden Erfahrungen unserer Gegenwart. Der französische Mittelalterhistoriker Philippe Buc, der nach einer Professur in
Stanford inzwischen in Wien lehrt, deckt mit großer Quellenkompetenz und ausgeprägtem Aktualitätsbezug die historischen Wurzeln dieses Geflechts auf. Sein Durchgang durch fast zwei Jahrtausende stimuliert und provoziert, bleibt aber stets von souveräner Kennerschaft und ausgeprägtem Methodenbewusstsein getragen. Philippe Buc gehört zu den bekanntesten internationalen Mittelalterhistorikern, sein neues Buch wird größte Aufmerksamkeit finden.« Professor Dr. Bernd Schneidmüller, Universität Heidelberg »Man liest dieses ungewöhnlich genaue Buch mit stockendem Atem: Es handelt von unserer Gegenwart, von einer Dialektik der Gewalt, die ihre Schärfe heute einmal mehr offenbart.« Frankfurter Rundschau »Ein ungewöhnliches, aufrüttelndes und nachdenklich stimmendes Buch« der Niederrhein »Heiliger Krieg, Terror, Terrorismus, ja selbst Märtyrertum - markant-bedrohliche Formen von Gewalt, mit der der international renommierte Mittelalterhistoriker Philippe Buc 2000 Jahre Geschichte des Christentums in der westlichen Welt konfrontiert. Mit ebenso souveränem Weitblick wie tiefgehender Analyse und Interpretation seiner Quellen schafft er weit mehr als nur den beabsichtigen 'Essay': Er schafft einen wichtigen Beitrag in einer allgegenwärtigen Debatte, nämlich den über das Verhältnis von Religion und Gewalt. Und mehr als das: Philippe Buc liefert eine Streitschrift, die provozieren will und dies auch kann, die vor allem die Theologie - und nicht nur die römisch-katholische - zu einem intensiven Blick in den Spiegel herausfordert, den der Historiker Buc dem Christentum vorhält.« Professor Dr. Hubert Wolf, Universität Münster »Dieses Werk hat die Gestalt eines großen Essays, in dem vehement, energisch und mit beindruckend weitem Horizont das Verhältnis des Christentums zur Gewalt analysiert wird. Die schon länger international heftig diskutierte Frage, inwiefern monotheistische Religionen in besonderer Weise gewaltaffin seien, findet hier eine gedankenreiche und scharfzüngige Antwort, die für Vormoderne wie Moderne überraschende und einleuchtende Bausteine zusammenfügt.« Professor Dr. Gerd Althoff, Universität Münster "I love this book. It is deeply imagined, enormously learned, and brings into conversation, with elegance and coherence, a series of analytical threads about the ideology of violence in the Western trajectory, that, now pointed out in this way, I see everywhere." Dr Cecilia Gaposchkin, Dartmouth College "Philippe Buc analysiert im kühnen Essay 'Heiliger Krieg' die 'christliche' Komponente von Gewalt." Das Buch gehört "in all jene (Theologen-)Hände, die das westliche Christentum vorschnell zur reinen Friedensreligion zurechtbiegen möchten." Otto Friedrich, Die Furche »Buc ist ein kluges, reichhaltiges Buch gelungen, das hoffentlich nicht nur in der Fachwelt, sondern bei allen kulturgeschichtlich Interessierten ein gebührendes Interesse findet.« Das Historisch-Politische Buch