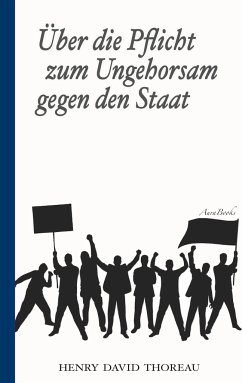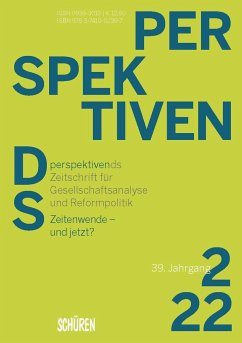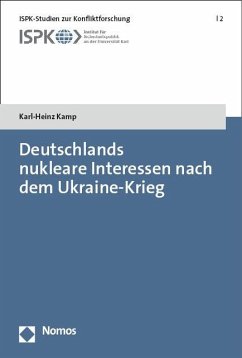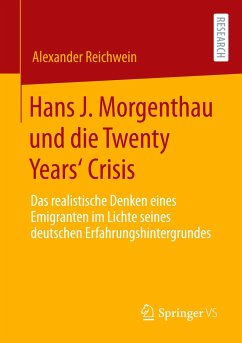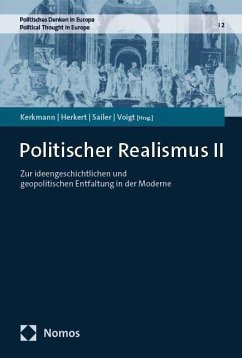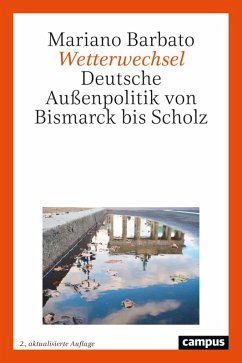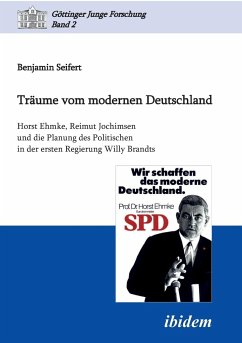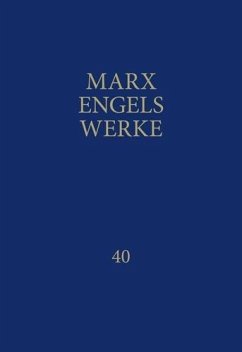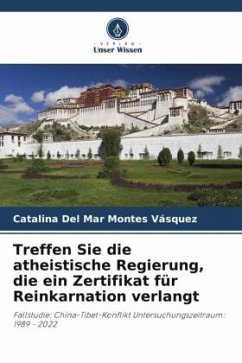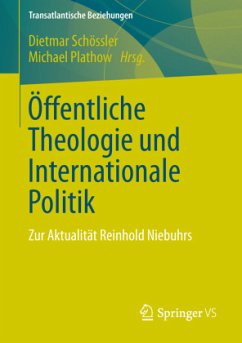Umweltschutz und Menschenwürde zu absurden Entscheidungen geführt.
Herdegens Argument zielt auf das Wechselverhältnis von Recht und Politik. Nicht um Rechtspolitik als Gesetzgebungsarbeit geht es ihm. Vielmehr hat der ebenso renommierte wie meinungsstarke Jurist, Direktor des Instituts für Öffentliches Recht der Universität Bonn, einen Verdacht: dass Rechtsprechung häufig nach dem Grundsatz verfährt, bestimmte Aufgaben seien zu wichtig, um sie der Politik zu überlassen - mit sonderlichen Ergebnissen. Statt, was ihre originäre Aufgabe wäre, darauf zu achten, dass der rechtliche Rahmen eingehalten wird, griffen Richter in politische Prozesse ein, für die in einer demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung andere zuständig seien. Diese politische Weiterung macht den Reiz des Bandes aus.
In einer Zeit, die schon jetzt als Ende einer Ära begriffen werden kann, sind reflektierte Bestandsaufnahmen wie diese hochwillkommen. Dabei gelingt es nicht zuletzt, den Umgang der Deutschen mit der "neuen Realität" des Krieges in einen größeren Deutungsrahmen zu spannen.
Im Mittelpunkt steht ein demokratietheoretisches Problem: Politische Entscheidungsprozesse wurden und werden immer öfter in ein Korsett richterlicher Vorgaben gezwängt. In Herdegens Augen droht deshalb der Verlust des Primats der Politik durch den politischen Gestaltungsanspruch der Gerichte. Für zweifelhaft hält er diesen Anspruch, weil die Macht der "Juristenkaste" nicht demokratisch legitimiert sei, was sie auch nicht durch höhere Einsichten wettmachen könne. Herdegen scheut die Ironie nicht und nimmt aber auch kein Blatt vor den Mund, wenn er der einen Seite Arroganz und Anmaßung, der anderen Ängstlichkeit und Selbstverzwergung vorwirft. Statt die Kraft zur eigenen Interpretation aufzubringen, verstecke man sich lieber hinter der richterlichen Klärung. Herdegen kritisiert eine Spielart des "Konstitutionalismus", in dem die demokratische Rechtmäßigkeit parlamentarischer Beschlüsse mit einer verfassungsrechtlichen Legitimität konkurriert, die sich häufig erst aus richterlichen Entscheidungen ergibt.
Dass Verfassungsnormen oft so angelegt sind, dass sie eine evolutionäre Auslegung erfordern, ist das eine. Etwas anderes ist ein "richterlicher Aktivismus", der im Hinblick auf die Sicht der Verfassungsgeber und die bestehende Auslegung überraschen muss. Mikromanagement ist eine Folge, etwa wenn das Bundesverfassungsgericht 2018 entschied, dass der FC Bayern einem Hooligan vorsorglich Stadionverbot erteilen dürfe, wenn er zuvor gehört und ihm eine schriftliche Begründung mitgeteilt wird, sofern er das wünscht.
Den Juristen erzürnt besonders, wie die Karlsruher Richter ihre Entscheidung zum Klimagesetz begründen: mit der Kurzatmigkeit des an Wahlperioden gebundenen politischen Prozesses und seiner mangelnden Fähigkeit, auf längerfristige Entwicklungen flexibel zu reagieren. Auf diese Weise werde das demokratische Legitimationsprinzip der auf Zeit verliehenen Macht in eine strukturelle Unfähigkeit umgedeutet, die Umwelt angemessen zu schützen. Ebenso wenig sei die Orientierung an tagespolitischen Interessen ein Manko, da deren Ausbalancieren nachgerade ein Wesensmerkmal der parlamentarischen Demokratie darstelle. Erneut zeigte sich jene Malaise, die dem Buch ihren Titel gibt: die Sehnsucht nach einer heilen Welt, selbst in der Zeitenwende.
Von einer Empathie getrieben, welche die ganze Welt verbessern will, gießen Richter humanitäres Handeln in Rechtsgrundsätze, die außerhalb des anerkannten Kernbereichs der Menschenrechte liegen, eher subjektive Vorstellungen widerspiegeln und dabei die Realität aus den Augen verlieren. Dieser Idealismus werde befeuert von einer "neuen Kultur der Empörung", die mediale Aufmerksamkeit verspricht; und medialen Netzwerken mit wechselseitigen Bestätigungsritualen (die Herdegen freilich selbst eifrig nutzt).
Den markantesten Verzerrungseffekt registriert er in der Skepsis der Deutschen gegenüber dem Einsatz militärischer Macht, was die Bedeutung des Bandes für die Gegenwartsbetrachtung erhöht. Da hat der Autor nicht nur jenen Pazifismus im Visier, der Frieden in der Ukraine auch um den Preis der Unterjochung fordere und moralische Schuld fürchte, wo es um die militärische Unterstützung der Selbstverteidigung in einem Vernichtungskrieg gehe. Herdegen spricht hier grundsätzlich jene Kriegsverdrängung und Kriegsvergessenheit in weiten Teilen der Öffentlichkeit an, die sich, so könnte man ergänzen, auch in den Gesellschaftswissenschaften beobachten lässt.
Vage bleibt der Bonner Jurist, wenn er die historischen Ursachen für diese Entwicklung benennt. Die Traumata des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs hätten das Misstrauen gegenüber dem Militär tief verankert. Das Ende des Kalten Krieges habe dann innere und äußere Sicherheit zugunsten von Umweltschutz und Antidiskriminierung von der Tagesordnung gedrängt. Die Beteiligung der Bundeswehr im Kosovokrieg habe keinen nachhaltigen Einstellungswandel herbeigeführt.
Hobbes oder Kant? Dem britischen Philosophen des Leviathan und seinem anthropologischen Pessimismus steht Herdegen erkennbar näher als dem deutschen Begründer des Idealismus. Gleichwohl empfiehlt er keinen rüden Rationalismus, sondern eine "abgewogene Rationalität". Entscheidungen sollten auf der Grundlage des verfügbaren Wissens, in einer in sich schlüssigen Argumentation und nach den Maßstäben praktischer Vernunft fallen. Wer wollte dem widersprechen? Dass die eigene Analyse mit dem Rationalitätsprinzip ihrerseits legitimiert wird, steht auf einem anderen Blatt. Alle demokratischen Organe, insbesondere das Parlament, aber auch die Rechtswissenschaft fordert Herdegen jedenfalls auf, das Schreckgespenst einer Regierung der Richter zu verjagen und so "die Anziehungskraft offener Politik in einer offenen Gesellschaft" zu stärken.
Auch wenn der Text häufig mäandert und die 84 Kapitelchen - viele kommen über einen Absatz nicht hinaus - als Orientierungshilfe nicht immer taugen: Der Band lässt sich als eine Streitschrift lesen, die juristisch und politisch untermauert ist und im richtigen Moment zum Nachdenken einlädt. Er lässt sich aber auch als Impuls für eine Geschichte der (deutschen) Demokratie einordnen, die Probleme des demokratischen Rechtsstaats und eine Transformation des Demokratischen in den Blick nimmt. JÖRG ECHTERNKAMP
Matthias Herdegen: Heile Welt in der Zeitenwende. Idealismus und Realismus in Recht und Politik.
C.H. Beck Verlag, München 2022. 339 S., 39,80 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
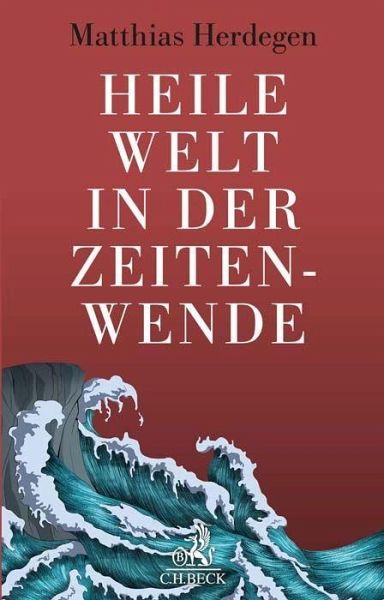




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.03.2023
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 21.03.2023