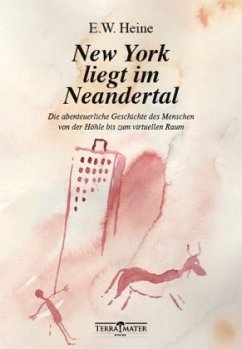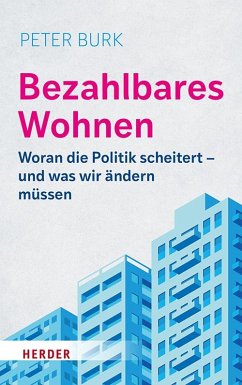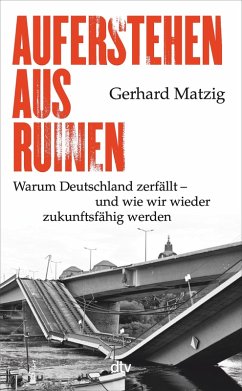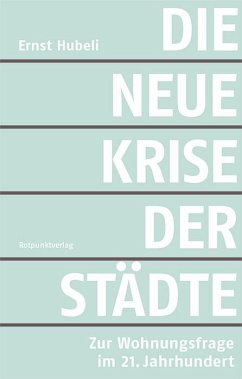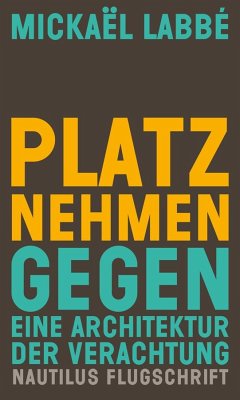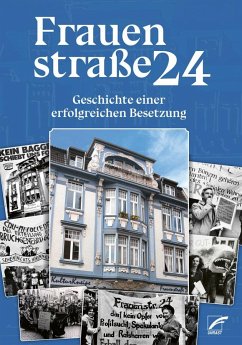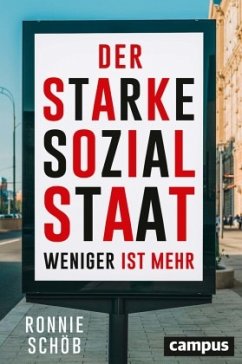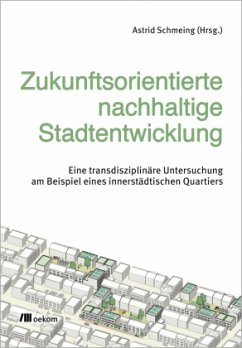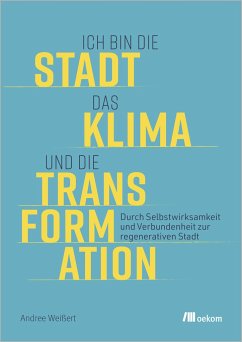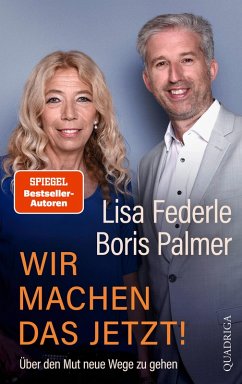1927, zählt zwar seit Jahrzehnten zu den profiliertesten und reflektiertesten deutschen Vertretern der teilnehmenden Beobachtung in Sachen Stadtentwicklung und Baukultur, doch er ist außerhalb der Disziplin eine weitgehend unbekannte Größe geblieben. Das vorliegende Buch ist deshalb auch ein lobenswerter Versuch, Denken und Wirken des in Ost und West gleichermaßen geschätzten Bruno Flierl einer Öffentlichkeit zu erschließen, die sich inzwischen gar nicht mehr vorstellen kann, über Stadt und Architektur anders nachzudenken als in Gestalt von Preisindizes und Renditeerwartungen.
Der Band versammelt die über einen längeren Zeitraum aufgezeichneten Gespräche zwischen Bruno Flierl und Frank Schumann, der als Verleger von Egon Krenz und Margot Honecker einen durchaus speziellen zeithistorischen Ackersaum der untergegangenen DDR bewirtschaftet und sich mit diesem Buch auf neues Terrain wagt. Denn für einen zielgruppenspezifisch verklärten Blick auf das sozialistische Damals ist Flierl der Falsche.
Beginnend mit einer ausführlichen Selbstbeschreibung, bilden die in zehn Kapitel gegliederten Interviews, grob gezeichnet, die thematischen Schwerpunkte im Lebenswerk Flierls ab: Stadtplanung und Städtebau in der DDR, industrieller Wohnungsbau, Hochhäuser, die Rolle von baubezogener Kunst im öffentlichen Raum - und immer wieder Berlin, wo sich die Vektoren mehrerer politischer Systeme und ihrer Architektur auf mitunter hochentzündliche Weise kreuzen. Dass es gelingt, diese abstrakten Fragestellungen in zugängliche und zum Teil sehr unterhaltsame Texte über das zeitspezifische Verhältnis einer Gesellschaft zu ihren städtebaulichen und architektonischen Hervorbringungen zu konvertieren, ist zum einen den unprätentiösen Schilderungen von Flierl selbst zu verdanken, zum anderen auch den von allzu viel Fachkenntnis und Insider-Sound ungetrübten Fragen seines Gesprächspartners. Eine großzügigere und dramaturgisch stärker mit dem jeweils verhandelten Sachverhalt verknüpfte Bebilderung wäre wünschenswert gewesen.
Der aus Schlesien stammende Bruno Flierl beginnt nach seiner Rückkehr aus zweijähriger Kriegsgefangenschaft in Frankreich ein Architekturstudium in West-Berlin und wechselt 1950, kurz nach der Gründung der DDR, in den Ostteil der Stadt. "Ich bin ohne Illusionen, aber mit Hoffnungen in die DDR gegangen", berichtet er. Denn so überzeugt der junge Flierl von der Idee eines sozialistischen Gemeinwesens ist, auch und gerade mit Blick auf seine eigene berufliche Zukunft beim Wiederaufbau, so abstoßend findet er den ideologischen Mummenschanz des SED-Regimes - "die plakative Propaganda, alte Formen für neue Inhalte: Aufmärsche mit Fackeln, Trommeln und Fanfaren bei der FDJ analog denen der HJ, die generelle Disziplinierung aller gesellschaftlichen Tätigkeiten, der Anspruch der Partei, immer recht zu haben".
Auf das hohle politische Bekenntnis wird er zeitlebens allergisch reagieren. Mit dieser Disposition gerät er, der selbst Parteimitglied ist, mit der SED bald in Konflikte. "Wegen Abweichungen von der Linie der Partei" wird Flierl, der nach dem Studium eine wissenschaftlich-publizistische Karriere eingeschlagen hatte, Mitte der sechziger Jahre als Chefredakteur der Zeitschrift "Deutsche Architektur" kaltgestellt. In der Bauakademie und als Dozent an der Humboldt-Universität forscht er weiter; die erhoffte Professur am Institut für Kulturwissenschaften bleibt ihm verwehrt.
Doch dass in der Mitte Berlins, das in diesen Jahren zum politischen Zentrum der DDR umgebaut wird, anstelle der vorgesehenen achtzehn Meter hohen Marx-Engels-Skulptur ein "Denkmal im Maßstab mitteleuropäischer Tradition, speziell im Geist von Auguste Rodin" entsteht und auch kein monumentales Regierungshochhaus, sondern der in seinen Maßstäben ungleich bescheidenere und von der Idee eines Volkshauses inspirierte Palast der Republik, ist Flierls beharrlicher Einflussnahme im Hintergrund zu verdanken.
Herrlich amüsant beschreibt er die verunglückte Planung der Ehrentribüne am Republikpalast, die für einen Millionenbetrag auf persönliche Anweisung Honeckers errichtet wird: "Bereits bei der Generalprobe der Militärparade am 1. Mai 1976 gerieten die Ehrengäste auf der Tribüne durch die Abgaswolken der Panzer und Fahrzeuge in Atemnot." Daraufhin verlagert die Partei- und Staatsführung die Umzüge an die Karl-Marx-Allee; das Forum vor dem Palast verkommt zum Parkplatz.
1982 wird Flierl vom Regime zur Persona non grata erklärt. Ein harmlos klingender Aufsatz mit dem Titel "Bildende Kunst im Stadtraum. Möglichkeiten und Grenzen", entstanden als Beitrag für den Katalog zur IX. Kunstausstellung der DDR in Dresden, hatte zusammen mit einem missliebigen Vortrag für so viel Unmut im Zentralkomitee gesorgt, dass Flierl in einem Parteiverfahren zu den Anklagepunkten "staatsfeindlich" und "konterrevolutionär" Stellung nehmen soll. Nur ein gesundheitlicher Zusammenbruch bewahrt ihn vor diesem Tribunal. Nach einem Schlaganfall und langwieriger Rekonvaleszenz muss er sich mit einem Dasein als Invalidenrentner abfinden.
Der fortan mit dem Privileg der Reisefreiheit ausgestattete Flierl denkt jedoch nicht daran, der DDR den Rücken zu kehren. Seine Expeditionen in die großen westlichen Metropolen weiten allenfalls den Hintergrund, vor dem er sich weiterhin mit den Entwicklungen zu Hause beschäftigt. Mit der Wende wachsen ihm praktisch über Nacht neue Aufgaben zu. Neben der Erarbeitung einer Gestaltungssatzung für den Pariser Platz ist Flierl in den Jahren der Wiedervereinigung vor allem damit beschäftigt, den oft auf der Freibank gehandelten städtebaulichen Nachlass der DDR vor dem rabiaten Zugriff mal mehr, mal weniger wohlmeinender Investoren und Planer zu bewahren.
Warum es dreißig Jahre nach dem Mauerfall so schlecht um die vielbeschworene "innere Einheit" steht, kann man in Teilen auch bei Flierl nachlesen. Wenn er von seinem - am Ende erfolglosen - Einsatz für den Erhalt des Republikpalastes erzählt oder die beabsichtigte bauliche Nachverdichtung des Areals zwischen Fernsehturm und Schlossneubau kritisiert, ist keine Bitterkeit zu hören, sondern das Sentiment des sozialistischen Romantikers. Oder wie er selbst sagt: "I had this dream."
CORNELIA DÖRRIES.
Bruno Flierl: "Haus Stadt Mensch". Über Architektur und Gesellschaft. Gespräche.
Verlag Das Neue Berlin, Berlin 2019. 288 S., Abb., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.05.2019
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 24.05.2019