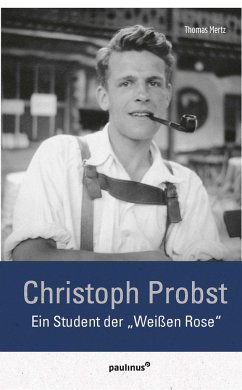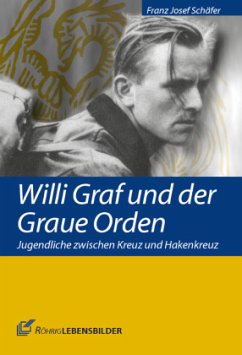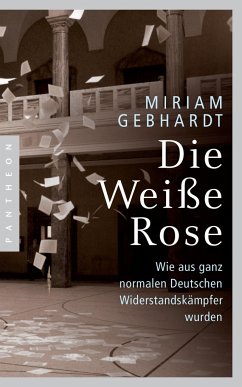besondere Stärke dieser Widerstandsgruppe hervorgehoben, ja Stärke zur Vorbedingung von Widerstand gemacht. Die "Weiße Rose" hingegen blieb eher im Windschatten solcher erinnerungspolitischer Auseinandersetzungen. Die Schwäche der Mitglieder der "Weißen Rose", ihr fehlender Zugriff auf Machtmittel, und die Form ihres Widerstandes, die Aufklärung über den Nationalsozialismus mit Flugblättern und Wandparolen, korrespondierten mit der Stärke ihrer moralischen Verurteilung des Nationalsozialismus und erregte in der Bundesrepublik wenig Anstoß.
Auch wenn die Formulierung "Geschwister Scholl" gerade zu einer stehenden Redewendung wurde, geriet Sophies älterer Bruder Hans in der öffentlichen Erinnerung immer stärker in den Schatten seiner jüngeren Schwester, obwohl er zusammen mit Alexander Schmorell die treibende Kraft innerhalb der Widerstandsgruppe der Weißen Rose war. Hans Scholl widmet jetzt die Archäologin und Historikerin Barbara Ellermeier ein mehr als vierhundert Seiten umfassendes Buch. Ihre Zielsetzung und die Forschungslage stellt die Autorin leider nicht vor. Vielmehr beginnt sie unvermittelt und spannt einen erzählerischen Bogen von Prozess zu Prozess. Die erste Szene des Buches findet Ende 1937 im Untersuchungsgefängnis Stuttgart statt, in das der junge Soldat Hans Scholl eingeliefert wurde. Der begeisterte HJ-Führer musste sich wegen bündlerischer Umtriebe und Devisenvergehen bei der Jugendarbeit rechtfertigen. Am Ende erzählt Frau Ellermeier vom Prozess der Geschwister Scholl vor dem Volksgerichtshof und von der Hinrichtung, bevor sie in einer Art Epilog das "Weiterleben" von Familie und Freunden "ohne Hans und Sophie Scholl" bis 1945 skizziert.
Dazwischen stellt sie - mit zu knappen Rückgriffen auf die Zeit vor 1937 - dar, wie sehr Hans Scholl auf der Suche nach sich selbst war und welche unbändige Sehnsucht nach Freiheit, Orientierung und Wahrheit ihn umtrieb. Sich selbst bezeichnete Hans Scholl einmal als "homo viator" und schrieb einer Freundin: "Erwarte nur nicht, einen ausgeglichenen Menschen vorzufinden, ich bin fortwährend ein Suchender."
Hans Scholls Drang nach Freiheit und sein Selbstverständnis als Teil einer geistigen Elite durchziehen untergründig die narrative Darstellung von Barbara Ellermeier, die stark den Perspektiven der vielen Briefe von Hans Scholl verhaftet bleibt. Die Bewältigung der psychischen Folgen des ersten Prozesses sollte Hans Scholl - so die Ellermeiersche Interpretation - lange Zeit beschäftigen, bis in sein Handeln im Widerstand hinein. Doch solche Linien muss der Leser selbst mühsam aus der detailverliebten Darstellung herausarbeiten, die sich zu oft in immer neuen, zum Teil parallelen Beziehungen zu jungen Frauen, Lektürelisten Hans Scholls oder ausführlichen Beschreibungen von Freizeitaktivitäten verliert. Wichtige Interpretationen versteckt die Autorin in Nebensätzen oder in eingestreuten Einzelsätzen, die bei der gewählten narrativen Darstellungsform, die in manchem an ein Skript für ein spannendes Radio-Feature erinnert, oft wie Fremdkörper wirken.
Autorin Ellermeier übergeht zudem zahlreiche Forschungskontroversen zur Weißen Rose. Die 243 Seiten umfassenden Quellennachweise in Form einer pdf-Datei muss man sich - aus Sicht des Rezensenten ein Ärgernis - über das Internet beim Verlag oder bei der Autorin bestellen. Doch trotz ihres Umfanges ermöglichen es diese Angaben nicht, nachzuvollziehen, warum sich die Autorin der einen oder anderen Interpretation vorliegender Veröffentlichungen zur Weißen Rose angeschlossen hat oder nicht. Die Nachweise geben nur Aufschluss über die verwendeten Quellen. Schließlich ist zu vermerken, dass Barbara Ellermeier entsprechend ihrer narrativen Darstellung die Inhalte der Flugblätter der Weißen Rose, die maßgeblich von Hans Scholl mitbestimmt wurden und für die er sein Leben riskierte und verlor, nur in Ansätzen analysiert. So lebendig und kurzweilig sie auch an vielen Stellen erzählt, wird ihre Analyse doch zu oft durch ihre fast dramaturgisch komponierte Darstellung verdeckt.
CHRISTOPHER DOWE
Barbara Ellermeier: Hans Scholl. Biografie. Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2012. 432 S., 24,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.07.2012
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 16.07.2012