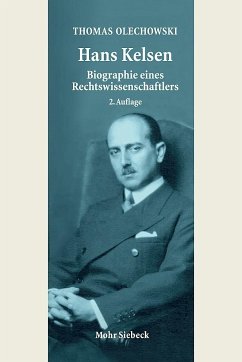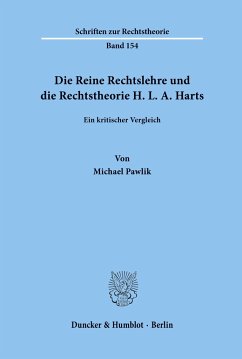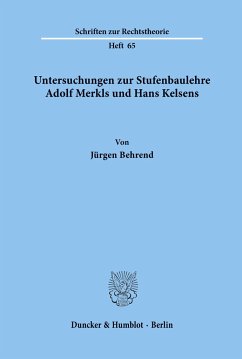in der er an Smends Lehre buchstäblich kein gutes Haar läßt. Wo Smend nach Einheit sucht, besteht Kelsen auf der Unhintergehbarkeit von Differenz. Der Möglichkeit einer Integration moderner Gesellschaften unter gemeinsamen Werten stehe deren ethische Fragmentierung entgegen. Und Smends Verständnis des Staates als einer geistig-sozialen Wirklichkeit mißachte die unübersteigbare Kluft zwischen Sein und Sollen, der Welt der Natur und jener der Normen.
Askese, nicht Überschwang ist Kelsen zufolge die dem Wissenschaftler geziemende Haltung. Die Rechtstheorie habe sich deshalb darauf zu beschränken, die formale Beschaffenheit der rechtswissenschaftlichen Grundbegriffe zu analysieren. Sobald sie darüber hinausgehe, entarte sie zur Ideologie. Dem Vertrauen Smends auf die Vernünftigkeit des Wirklichen setzt Kelsen damit eine rigorose Nichtachtung des Faktischen entgegen. Der späte Erbe Hegels und das Kind des Neukantianismus haben einander nichts zu sagen. Aber läßt sich die radikale Diät, die Kelsen der Rechtstheorie verordnet, überhaupt durchhalten? Führt sie statt zu deren Genesung nicht vielmehr zu ihrem Kollaps? An dieser Frage scheiden sich bis heute die Geister. Auch unter den Referenten des von Stanley Paulson, dem führenden amerikanischen Kelsen-Forscher, und Michael Stolleis herausgegebenen, qualitativ durchweg hochwertigen Tagungsbandes über Kelsen als Staatsrechtslehrer und Rechtsphilosoph sind die Meinungen geteilt.
Zu den bekanntesten Einwänden gegen Kelsens Reine Rechtslehre gehört das Bedenken, die Beschränkung der rechtstheoretischen Analyse auf tatsächlich wirksame Rechtsordnungen, zu der sich der Positivist Kelsen gezwungen sieht, entziehe dem Bestreben des Normativisten gleichen Namens, das Recht als eine reine Sollensordnung zu begreifen, die Grundlage. Der Oxforder Rechtsphilosoph Joseph Raz hat diese Kritik vor einigen Jahren präzisiert. Zur Begründung der Stellung einer normsetzenden Autorität reiche die Berufung auf ihre faktische Durchsetzungsmacht nicht aus; dazu bedürfe es vielmehr rechtsethischer Argumente. Alexander Somek stimmt Raz zu. "An irgendeinem Punkt der Begründung ist auszusprechen, warum es für alle oder für jeden besser ist, den Anforderungen einer Autorität zu folgen, als ihnen nicht zu folgen." Weil Kelsens Positivismus eine solche Begründung nicht zulasse, unterminiere er sich selbst.
Eugenio Bulygin fordert, daß die Fragen, wann eine Norm zu einem Rechtssystem gehört und wann eine Norm verbindlich ist, klar voneinander getrennt werden sollten. Normativität in dem schwachen Sinn der Zugehörigkeit zu einem Normensystem gebe es selbstverständlich auch unter der Herrschaft eines positivistischen Rechtsbegriffs. Aber auch der starke Begriff von Normativität als Verbindlichkeit lasse sich ohne weiteres in ein positivistisches System einfügen. Es genüge, daß eine positive Rechtsnorm existiere, die den Richter verpflichte oder ermächtige, bestimmte andere Rechtsvorschriften auf einen gegebenen Fall anzuwenden. Logisch spricht in der Tat nichts dagegen, den Normativitätsbegriff in einem derart verengten Sinn zu verstehen. Handlungstheoretisch betrachtet, ist eine solche Position indessen zum Scheitern verurteilt. Ein Richter, der Wert darauf legt, sich auch während seiner Berufsausübung als moralisches Subjekt achten zu können, wird die ihm von Kelsen und Bulygin empfohlene positivistische Schonkost zurückweisen. Er kann gar nicht anders, als der von ihm exekutierten Rechtsordnung auch eine rechtsethische Verbindlichkeit zuzuschreiben. Positivismus ist eine Haltung, die zwar dem Beobachter eines Rechtssystems gut ansteht, nicht aber einem Teilnehmer an ihm.
Nicht weniger gewichtig als die Einwände gegen Kelsens Normativitätsverständnis sind die Bedenken gegen seine Folgerungen aus dem Sein-Sollens-Dualismus. Sein und Sollen, das ist für Kelsen gleichbedeutend mit der Alternative: Naturordnung oder Normenordnung. Tertium non datur. Zu Recht fragt indessen Ulfrid Neumann im Anschluß an den großen Staatstheoretiker Hermann Heller: Kann es wirklich befriedigen, das gesellschaftliche Phänomen Recht, sobald man es nicht als eine faktizitätsenthobene reine Sollensordnung betrachtet, in ein "naturalistisches Gewühl unverbundener sinnlicher Realitäten" zerfallen zu lassen? Daß Smend und mit ihm viele andere Rechtslehrer der Weimarer Zeit darin eine unakzeptable "Entleerung" des Rechtsbegriffs erblickten, hing nicht nur - worauf Martin Schulte maßgeblich abhebt - mit der weitverbreiteten Sehnsucht nach Einheit in einem "Jahrzehnt größter annehmbarer Unsicherheit" zusammen. Es hatte vielmehr auch eine von den besonderen Zeitumständen unabhängige sachliche Berechtigung. Die Reine Rechtslehre bleibt gegenüber der Realität des Sozialen eigentümlich sprachlos.
Die Frage kann nur sein, ob man die erforderlichen Ergänzungen unter Anerkennung oder unter Überwindung von Kelsens wissenschaftstheoretischen Prämissen vorzunehmen sucht. Smend - dessen Kontroverse mit Kelsen von Stefan Korioth packend nachgezeichnet wird - entschied sich für die letztere Möglichkeit. Neumann bemüht sich hingegen um eine mit den methodischen Vorgaben Kelsens kompatible Lösung des Problems. Er plädiert für die "Anerkennung eines vorwissenschaftlich konstituierten Gegenstandsbereichs Recht", der als eigenständiger Bereich der sozialen Wirklichkeit vor dem wissenschaftlichen Zugriff der Rechtswissenschaft liegt.
Die ontologische Dichotomie zwischen Sein und Sollen schwächt sich in dieser Lesart ab zu einer methodologisch gebotenen Unterscheidung verschiedener Untersuchungsperspektiven, die sich indessen alle auf ein und dasselbe Feld sozialer Praxis beziehen. Dieser Lösungsvorschlag rückt Kelsen nahe an das kulturwissenschaftliche Rechtsdenken des Heidelberger Neukantianismus mit Emil Lask und Gustav Radbruch als seinen beiden Galionsfiguren heran. Darüber hinaus markiert er einen bedeutsamen Schritt zur Überwindung des vermeintlich unüberwindlichen Abgrundes zwischen neukantianisch und hegelianisch inspirierten Rechtslehren. Auch die an Kelsen orientierten Auffassungen sollten in Zukunft nicht mehr hinter die Erkenntnis zurückfallen, daß die soziale Welt eine Realität sui generis darstellt.
Die Rechtswissenschaft kann sich diese Welt zwar ihren normativen Anliegen gemäß deutend anverwandeln. Sie spielt aber nicht die Rolle Jung Siegfrieds, dessen erlösenden Kusses die schmachtende Gesellschaft harrt, damit er sie aus ihrer Naturverfallenheit befreie. Das Nonplusultra der Rechtstheorie stellt die Reine Rechtslehre mithin nicht dar. Ausdiskutiert ist sie aber - das macht der vorliegende Band deutlich - noch lange nicht.
MICHAEL PAWLIK
Stanley L. Paulson, Michael Stolleis (Hrsg.): "Hans Kelsen". Staatsrechtslehrer und Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts. Verlag Mohr Siebeck, Tübingen 2005. XI, 392 S., br., 69,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main






 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.08.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 17.08.2005