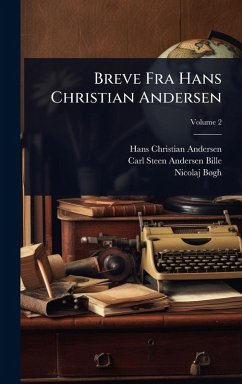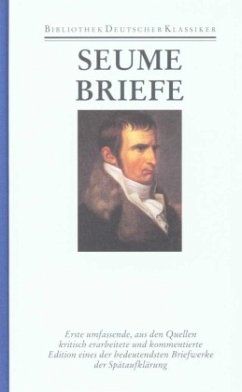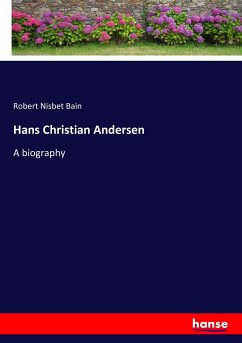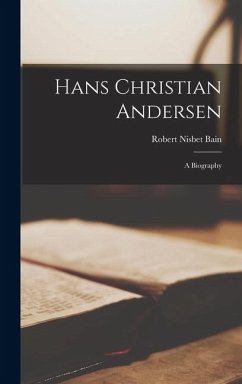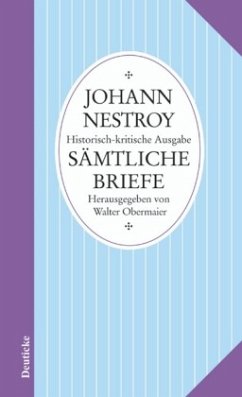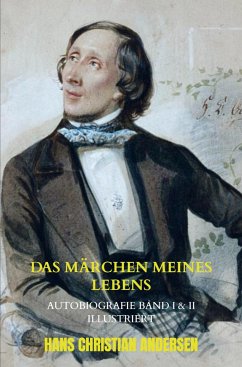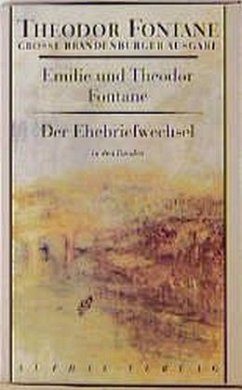Freunden im Auslande zu den theilnehmendsten rechnen kann".
Unter allen Freunden im Ausland - er hätte hinzufügen können: und ausgerechnet in Deutschland. Denn es hatte sich, als er diese Zeilen schrieb, der erste deutsch-dänische Krieg um die Herrschaft in Schleswig-Holstein angekündigt; als er im Jahr darauf ausbrach, zerstörte er für lange Zeit auch die engen, oft freundschaftlichen Beziehungen Andersens zu seinen deutschen Förderern und Lesern. In Deutschland hatte er seinen literarischen Durchbruch erlebt, hier fühlte er sich seither beinahe so zu Hause wie in Dänemark. Die Entzweiung der beiden Länder im Zeichen eines noch neuen Nationalismus hat er denn auch, seinen brieflichen Schilderungen zufolge, als einen schmerzhaften Riß erlebt, der ihm durch den Leib gehe. Um so erstaunlicher diese Freundschaft mit der geistreichen und teilnehmenden Hofrätin aus Oldenburg in einem nun erstmals edierten Briefwechsel, den man ohne Übertreibung eine Entdeckung nennen darf.
Allein die Hofrätin ist hier in Wahrheit Andersens Briefpartnerin; ihr gebildeter und politisch einflußreicher Gatte beschränkt sich auf einige trotz wiederholter Freundschaftsbekundungen doch amtlich korrekte Zeilen. Anders Lina von Eisendecher. Diese Frau kennengelernt zu haben ist nicht die kleinste unter den schönen Überraschungen, die dieser Briefwechsel bereithält. So offensiv, wie die Konventionen es nur eben zulassen, macht sie sich 1843 an den Dichter heran, dessen Romane und Reisebücher, "Märchen und Geschichten" sie so bewundert wie so viele ihrer Landsleute. Namentlich in der Jüdin Naomi, der gefährlich emanzipierten Heldin seines Erfolgsromans "Nur ein Spielmann", glaubt sie sich selbst wiederzuerkennen; "der Naomi kann ich alles nachfühlen".
Was zunächst wie einigermaßen zudringliche Fanpost aussieht, wird bald zu einem Dialog in Augenhöhe, an dem sich der Umworbene dankbar, ja erleichtert beteiligt. Das liegt nicht nur daran, daß die anfangs beunruhigende erotische Komponente sich als unverfängliche Spielerei erweist, sondern vor allem daran, daß die Begeisterung für Dichter und Dichtung sich hier verbindet mit ausgesprochener Kennerschaft und einem Urteilsvermögen, von dem die "schwesterliche Güte" sehr selbstbewußt Gebrauch macht. Von Lina von Eisendecher läßt Andersen, der ewig Lobeshungrige, sich auch so unangenehme Wahrheiten sagen wie die, daß die unheimliche Zigeunerin seiner jüngsten Geschichte doch eher eine überflüssige Staffagefigur sei und daß er sich lieber an jene "einfachen Zustände" halten solle, die er poetisch verzaubern könne, "das verstehen Sie wie Niemand".
Es ist ein anrührendes Schauspiel, wie Andersen gegenüber dieser klugen und energischen Leserin nach und nach seine üblichen Rollenspiele aufgibt, wie er sich erleichtert gehen läßt. "Anerkennung macht mich sonderbar weich und demüthig, erweckt in mir Angst", warnt er gleich zu Beginn; aber "ich weiß, ich darf an Sie in allen meinen Stimmungen schreiben". Diese Unbefangenheit zeigt sich am anschaulichsten in seiner Sprache. Denn Andersen antwortet in einem Deutsch, das er so geschmeidig wie eigenwillig behandelt. Eigentlich ist ihm jede Unsicherheit eine Pein; "ich bin wie ein Vöglein ohne Flügel, wenn ich in einer fremden Sprache auftreten muß", klagt er in einem der ersten Briefe nach Oldenburg. Und wirklich verschwindet dieser Schmerz in anderen deutschen Korrespondenzen Andersens nie ganz, bis er ihm, mit dem Aufkommen der nationalistischen Gegensätze, geradezu wie eine Bestätigung einer doch unüberwindlichen Fremdheit in Deutschland erscheint - so im etwa gleichzeitig geführten Briefwechsel mit dem Weimarer Herzog Carl Alexander, an dessen Musenhof Andersen doch zeitweise sogar eine zweite Heimat zu finden gehofft hatte.
Ganz anders hier. Bereits nach seinem ersten Besuch bei den Eisendechers nämlich faßt Andersen einen bemerkenswerten Entschluß: "Da ich ginge aus Oldenburg, haben Sie gesagt, ,je mehere Fehler in Ihre Brief, des besser' - nun sind Sie heute zufrieden? Erste Mahl ins Leben habe ich, ohne Klade, ohne koregieren, ganz ungenirt, so wie, wenn ich eine dänische Brief schreibe, dieses geschrieben, Gott weiß um Sie etwas davon verstehen! Ich fürgte Sie muß sagen wie meine kleine Freund im Hause: ,Er spricht ganz sonderbar!'" Man versteht ihn sogar sehr gut; denn so spontan und ungeniert wie hier hat man Andersen selten erlebt. Wahrhaftig "ohne Klade" plaudert er drauflos, von seinen hypochondrischen Leiden ("bin ich gräßlich mit Zahnschmerz gequällt, ach ich habe sehr gelitten", "ich bin beinahe ertrunken"). Er erzählt von seinen Reisen kreuz und quer durch Europa und von seinen neuen Arbeiten, kommentiert das literarische Zeitgeschehen, prahlt wie immer mit den berühmten Menschen, denen er begegnet ist und die ihn gelobt haben, und redet freimütig von Ängsten und Selbstzweifeln - und, je näher der absehbare Krieg rückt, von seiner Verzweiflung über die politische Lage. "Der Krieg ist ein furchtbares Ungeheuer!"
Gerade angesichts dieser politischen Kontexte liest sich dieser Briefwechsel wie ein ermutigendes Gegenstück zur Korrespondenz mit dem Weimarer Erbgroßherzog, against all odds. Dort werden, unter dem immer mehr zur rhetorischen Floskel verkommenden Freundschaftskult, die privaten Beziehungen unrettbar zwischen den nationalen Fronten zerrieben - hier bewähren sie sich über alle nationalen und sprachlichen Grenzen hinweg, in einem gegenseitigen Verständnis, das ebendeshalb allen Bedrohungen standhält, weil jeder so reden darf, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. "Verstehen Sie! - O, wenn Sie doch Dänisch lesen könnten, dann sollte ich mich ausdrücken konnen, sprekken, plaudern, erzehlen, aber jezz - ja! - ich bin prostituirt." Eben weil er hier so ungezwungen sprekken darf, vermag er sich der Freundin so gut verständlich zu machen. Kann er sich nach einer seiner strapaziösen Reisen ein wenig erholen, seufzt er, nun sei er "endlich im Ruhestand". Auch habe er "sex neue Märchen" geschrieben, darunter "der häsliche Ente-Junge! (ja wie heis das ins Deutsch, es ist das Kind eine Ente, aber maskulinum)". Über die Komik mancher Sprachschnitzer lacht dabei niemand so herzlich wie er selbst, manchmal mitten in einem sentimentalen Gefühlsausbruch: "Wie viele innige und wahre Freunde hat der Herr Gott mir / mich (wie Sie wollen) gegeben."
Erik Dal, Doyen der dänischen Andersen-Forschung, und Paul Raabe haben dieser wunderbaren Korrespondenz das Gewand geschneidert, das sie verdient. Ausführlich und erfreulich gleichberechtigt werden beide Briefpartner vorgestellt; die Briefe werden angenehm lesbar kommentiert und überdies durch Auszüge aus Andersens Tagebüchern und autobiographischen Schriften so ergänzt, daß der Band sich über weite Strecken fast wie ein Briefroman liest; zeitgenössische Dokumente ergänzen das Bild. Das letzte von ihnen ist, wie könnte es anders sein, ein Märchen von Andersen. Geschrieben hat er es für jenen "kleinen Freund", der seine Redeweise so "sonderbar" fand: Lina von Eisendechers Sohn Carl, genannt Tuk. Für ihn schreibt Andersen das Märchen vom "kleinen Tuk", der sich in der Schule die dänischen Städte nicht merken kann und von dieser Sorge buchstäblich im Schlaf befreit wird. Er habe den Jungen also "zum Kopenhagener gemacht", entschuldigt er sich in einem Brief an seine Freundin, das sei nun der Dank für die Gastfreundschaft - "Ich stehle die Kinder und mache sie zu Kopenhagenern!"
Das hat er allerdings getan, mit ungezählten Kindern in der Welt; und in seinem zauberhaft falschen Deutsch gesteht er es nun ein, über ein zur dänischen Märchenfigur gewordenes Kind aus Deutschland. Schöner ist der Widerstand der Poesie gegen den Ungeist eines kriegerischen Nationalismus selten formuliert worden.
Hans Christian Andersen / Lina von Eisendecher: "Briefwechsel". Herausgegeben von Paul Raabe und Erik Dal. Wallstein Verlag, Göttingen 2003. 494 S., 22 Abb., geb., 38,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.07.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 26.07.2003