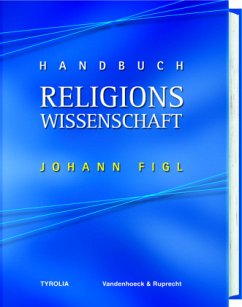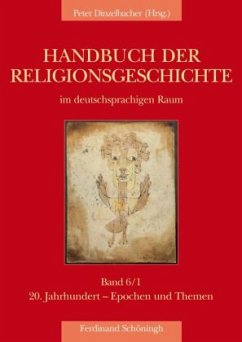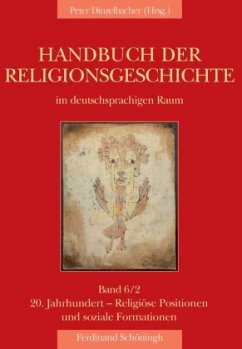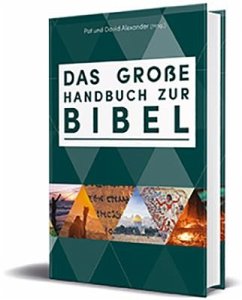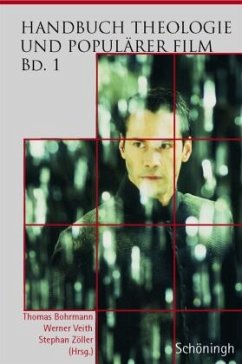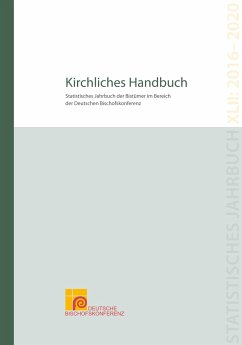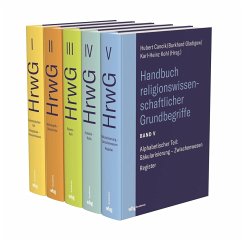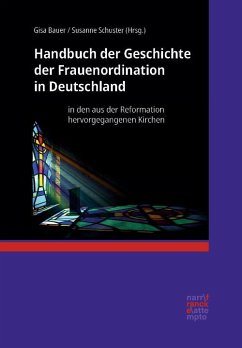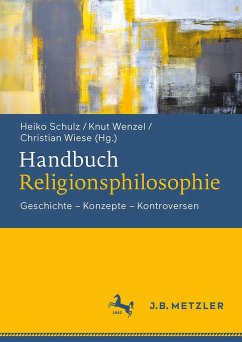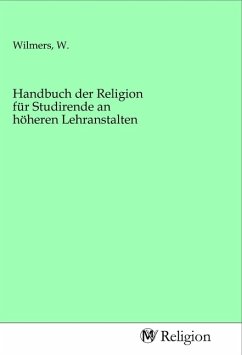Handbuch Religionswissenschaft
Religion und ihre zentralen Themen
Herausgegeben: Figl, Johann
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
140,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Überblicksartikel informieren über einzelne Religionen wie Islam, Buddhismus und andere Religionen, aber auch das Christentum; dabei sind nicht nur heute bestehende Religionen, sondern auch sogenannte »ausgestorbene« Religionen (wie die ägyptische oder keltische Religion) berücksichtigt. Themen, die die Religionen verbinden oder trennen, die ihnen gemeinsam sind oder die sie unterscheiden (wie Vorstellungen über das Leben nach dem Tod oder Wiedergeburtslehren), sind ausführlich behandelt. Sie verfolgen die Intention, eine Darstellung bzw. Grundlegung der Religionswissenschaft als akade...
Überblicksartikel informieren über einzelne Religionen wie Islam, Buddhismus und andere Religionen, aber auch das Christentum; dabei sind nicht nur heute bestehende Religionen, sondern auch sogenannte »ausgestorbene« Religionen (wie die ägyptische oder keltische Religion) berücksichtigt. Themen, die die Religionen verbinden oder trennen, die ihnen gemeinsam sind oder die sie unterscheiden (wie Vorstellungen über das Leben nach dem Tod oder Wiedergeburtslehren), sind ausführlich behandelt. Sie verfolgen die Intention, eine Darstellung bzw. Grundlegung der Religionswissenschaft als akademische Disziplin in wesentlichen Aspekten zu geben.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.