Genauigkeitsansprüchen des Verfassers müßte eine neutrale Stelle die Gerichte zu seinen Vorwürfen hören und dann entscheiden. Eine solche Stelle gibt es aber nicht, also auch keine Gerechtigkeit im ewigen Konflikt zwischen Anwälten und Richtern. Bei näherer Betrachtung kann die Justiz den Angriff auch aushalten. Man muß allerdings zwei Ebenen der Argumentation unterscheiden.
Auf der ersten Ebene kommentiert der Verfasser sieben Fälle: Ein Staatsanwalt wird von seiner Lebensgefährtin zu Unrecht der Vergewaltigung bezichtigt. Ein Sonderling erschießt seine Gefährtin in einer Liebesnacht. Ein Türke erschießt seine Frau, die ihn verlassen hat. In einer Familienfehde sticht ein Sinti einen anderen nieder. Ein griechischer Bordellbetreiber erschießt einen Neonazi. Ein Kurde tötet ein Mitglied einer feindlichen Sippe. Ein Vollstreckungsschuldner demoliert das Amtsgericht. In fast allen Fällen hat der Verfasser die Täter verteidigt. Sie haben daher entweder im Affekt oder in Notwehr gehandelt.
Die Gerichte haben das anders gesehen. Deshalb wirft ihnen der Verfasser Rechtsbeugung vor. Der Rezensent hält es für möglich, daß die Gerichte die Fehler begangen haben, die den Verfasser empören. Die meisten Konflikte hatten mit kulturellen Differenzen zu tun, bei denen Richter an die Grenze ihrer Verstehensmöglichkeiten geraten und deshalb zum "Durchhauen" neigen. Aber Rechtsbeugungen wären die Fehler allenfalls, wenn man darunter mit dem Verfasser verstehen müßte, daß der Richter "in einem Verfahren einzelne Tatsachen oder den Sachverhalt insgesamt verfälscht, wenn er die Gesetze falsch anwendet oder bei der Strafzumessung seinen Ermessensspielraum überschreitet".
Mit solchen Fehlern rechnet das System und hat deshalb Rechtsmittel vorgesehen. Bei der Rechtsbeugung muß es sich also um eine andere als die "normale" Rechtswidrigkeit handeln. Das führt in eine Paradoxie. Man muß zwischen Rechtswidrigkeit und Rechtswidrigkeit nach einem rechtlichen Kriterium unterscheiden. Eigentlich geht das nicht. Die herrschende Lehre will nach dem Willen der Richter unterscheiden. Das kann man mit dem Verfasser für unbefriedigend halten. Aber dann muß man ein besseres Kriterium nennen. Darum bemüht sich der Verfasser jedoch nicht.
Der Grund zeigt sich auf der zweiten Ebene. Es sind das Unrecht, das Gerichte aus ideologischen Motiven in der NS-Zeit begangen haben, und seine fehlende Ahndung nach 1945. Nach Ansicht des Verfassers "ist das richterliche Standesbewußtsein aus dieser Tradition heraus ins Unantastbare gewachsen". Das ist weder stil- noch geschichtssicher. Die Richterschelte des Verfassers hat Kurt Tucholsky in der Weimarer Zeit weit überboten und damals den preußischen Obrigkeitsstaat verantwortlich gemacht. "Falsche Vergangenheit" scheint zu den typischen Gründen für "falsche" richterliche Ansichten zu gehören. Aber das mag auf sich beruhen. Wichtiger ist der radikalistische Umgang des Verfassers mit dem Problem des NS-Unrechtes. Er verteidigt den Morgenthau-Plan, der bedeutet hätte, "Deutschland in ein Agrarland zurückzuverwandeln und alle Nazifunktionäre zur Zwangsarbeit in einen Steinbruch zu schicken". Das wäre nicht besonders rechtsstaatlich gewesen, der Verfasser wäre kaum prominent geworden, und der Rezensent hätte diese Publikation nicht besprechen können. Aber die Vereinigten Staaten waren eben humaner und politisch klüger als die Gerechtigkeit des Verfassers.
Richtig ist, daß die Gerichte in der NS-Zeit, soweit sie Fragen mit ideologischem Einschlag zu entscheiden hatten, vielfach empörendes Unrecht gesprochen haben, daß nach 1945 nur wenige Richter bestraft und die meisten wieder in den öffentlichen Dienst eingestellt worden sind. Die Wiedereinstellung war unverhohlene Politik in Bund und Ländern, wie der Fall des Adenauer-Staatssekretärs Hans Globke belegt. Die frühere DDR dagegen hat (fast) alle NS-Richter ausgeschlossen und sich bis zur Produktion eigener Justizkader mit in wenigen Wochen ausgebildeten Volksrichtern beholfen. Das Ergebnis: Die Entscheidungen der Volksrichter kann man heute nicht mehr vorzeigen, die der Richter mit den braunen Flecken auf der Weste sehr wohl. Die Bundesbürger sind mit der westdeutschen Politik beträchtlich besser gefahren.
In seiner Empörung versteigt sich Bossi zu dem Satz: "All die schlimmen Urteile deutscher Nachkriegsgerichte, von denen hier die Rede war und die in übelster Kumpanei einen Abgrund von Justizverbrechen zugeschüttet haben, müssen daher auf dem Wege der Gesetzgebung für ungültig erklärt werden." Ob das mit der Gewaltenteilung vereinbar wäre? Ist der Gesetzgeber unschuldiger als der Richter? Und was geschieht mit den NS-Richtern, die damals freigesprochen wurden? Gewiß, inzwischen sind wohl alle verstorben. Trotzdem wäre die Aufhebung nicht nur ein symbolischer Akt, wie der Verfasser meint. Sie wäre ein Präjudiz. Das nächste Mal würde der Gesetzgeber mit einer mißliebigen Rechtsprechung eben früher aufräumen. Sollen die ursprünglich Freigesprochenen dann noch in den Knast wandern? Oder hat die Berufung auf das NS-Justizunrecht vornehmlich den Sinn, dem Prominentenanwalt das Geschäft zu erleichtern?
Fast möchte man es glauben, wenn man über bundesdeutsche Richter liest: "In der Tradition jener NS-Rechtsbrecher in Robe stehend und in dem aus Erfahrung sicheren Bewußtsein, weitgehend ungestraft zu bleiben, beugen sie auch heute das Recht und produzieren eigene ,revisionssichere' Urteile."
GERD ROELLECKE
Rolf Bossi: "Halbgötter in Schwarz". Deutschlands Justiz am Pranger. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2005. 280 S., geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
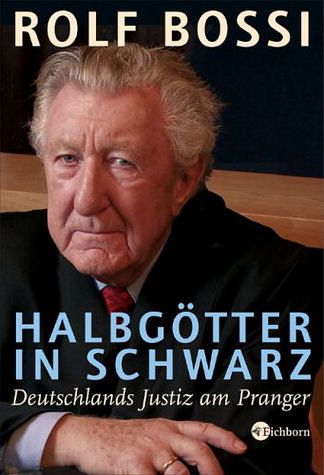




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.04.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 06.04.2005