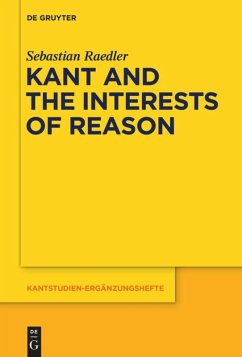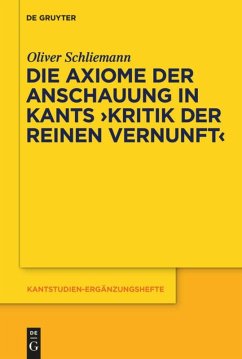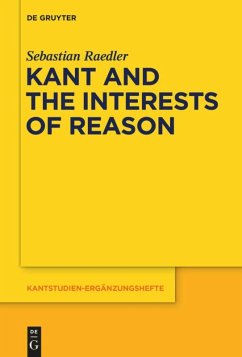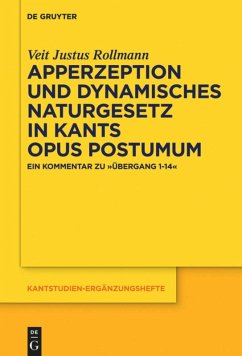Dieter Henrich und Manfred Frank Jacobi für die Geschichte des Frühidealismus und der Frühromantik wieder. Die in einigen Bänden schon erschienene Ausgabe der Werke und Brief Jacobis erleichtert das seitdem verstärkte Studium Jacobis.
Dazu gehört jetzt auch die Habilitationsschrift von Birgit Sandkaulen, die eine "systematische Darstellung des systemkritischen Philosophierens" Jacobis darstellen will. Sandkaulen scheitert auf hohem Niveau. Dieser Eindruck stellt sich nicht nur aufgrund der Enttäuschung des Lesers ein: Am Ende der Studie, nach über 260 Seiten dichter und oft überanstrengter Argumentation, muß er die postmodernen Glocken läuten hören. Denn Jacobis entscheidende Leistung besteht nach Sandkaulen darin, eine grundlegende "Differenz der Andersheit" herausgearbeitet zu haben. Sie inthronisiert Jacobi mithin als Vorläufer Derridas. Es ist auch nicht nur der oft peinlich apologetische Ton, mit dem Sandkaulen sowohl gegen zeitgenössische Kritiker, insbesondere Hegel, als auch gegen aktuelle Interpreten, insbesondere Hermann Timm, zu Felde zieht, um die Kohärenz und - ja tatsächlich - die aktuelle Bedeutung der Philosophie Jacobis zu propagieren. Es ist vielmehr und vor allem die Nachahmung der stilistischen und argumentationstechnischen Eigenheiten Jacobis, die auch aus sachlichen Gründen zum Widerspruch herausfordern. Denn im Furor "Jacobi ernstnehmender" Rekonstruktion geht die analytische Distanz verloren.
Jacobis Stil und Argumentation entspricht seinem Interesse, die personale Identität des christlichen Gottes zu beweisen und die Paradoxien, Widersprüche und Antinomien der Vernunft zu beschreiben oder auch zu verdecken. Der systematische Irrationalismus Jacobis gebiert Metaphern. Wie Jacobi schreibt Sandkaulen diesen Metaphern aber Begriffscharakter zu. Dieses Verfahren betrachtet die Scharlatanerien Jacobis bei der Vermischung von Bild und Begriff mit dessen eigenen Mitteln. Wie Sandkaulen beispielsweise mit den Bildern der "Aufgrabung" (gemeint ist die historische und systematische Rekonstruktion der Metaphysik Spinozas und ihrer Tradition) oder der Gegenüberstellung von "Unphilosophie und Alleinphilosophie" verfährt, ist ein Musterbeispiel für die Formen höherer Paraphrase: Die Verdunklungsleistungen werden schlicht, aber gekonnt reproduziert. Nur wer diese begriffslogischen Schwindeleien selber schätzt, kann urteilen, daß Jacobis "Topos des Glaubens keine religiösen Konnotationen trägt".
Die eigentliche Leistung der Studie besteht aber in der Rekonstruktion der Metaphysik der Spinoza-Briefe, vor allem des zur Konturierung des Freiheitsbegriffs entwickelten "wesentlichen Unterschieds von Grund und Ursache". Sandkaulen zeigt, daß Jacobi sich mit diesem Unterschied aufhält, um die Freiheit des Handelns gegenüber einer nach dem Satz des zureichenden Grundes durchgehend determinierten Welt zu retten. Seinen Freiheitsbegriff kann - und will - Jacobi nicht begründen, man muß ihn fühlen.
Ebenso verhält es sich mit dem Begriff des Grundes, dessen Gültigkeit Jacobi nur durch einen Akt des Glaubens gewahrt sieht - ein zentraler Sachverhalt, den zwar Hegel, nicht aber Sandkaulen erkennt. Jacobis Kritik an der unzulässigen "Vermischung von Grund und Ursache" durch die traditionelle Metaphysik hat in diesen - antiaufklärerischen - Intentionen ihren Ursprung. Weil diese "Rettung der Freiheit streng philosophisch nicht bewiesen werden kann", erhebt Sandkaulen Jacobi zum Vertreter einen sogenannten "anderen Aufklärung". In seiner "Verklammerung von Freiheit und Vernunftkritik" verläßt Jacobi jedoch den Boden jeder Aufklärung. Seine Gefühls- und Glaubensphilosophie ist mitnichten Ausdruck einer "anderen Aufklärung". Wenn Jacobi den Glauben in den Satz vom zureichenden Grunde einbaut oder die Freiheit auf das Gefühl gründet, zeigt sich vielmehr, daß sein "Überschlag (salto mortale) von Begriffen zum Undenkbaren" zum - wie Kant sich ausdrückte - "Tod aller Philosophie" führen muß. Solcher Tod ist keine ,andere Aufklärung', er ist Gegenaufklärung.
GIDEON STIENING.
Birgit Sandkaulen: "Grund und Ursache". Die Vernunftkritik Jacobis. Wilhelm Fink Verlag, München 2000. 277 S., br., 34,77 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
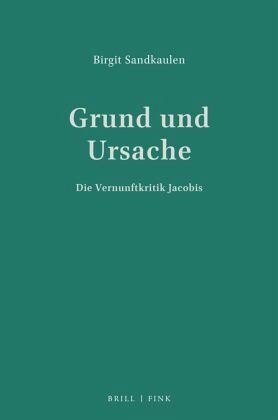




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.01.2002
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 04.01.2002