nicht vor.
Moritz klagt aufgrund von Einzelfakten an. Das fällt relativ leicht, weil der österreichische Katholizismus weiter rechts stand als der deutsche, weil der katholische Antijudaismus in Österreich weit verbreitet war und weil es dort auch heftige Judengegner gab, die für den Rassismus anfällig wurden. Erika Weinzierl und Maximilian Liebmann haben darüber viel und gut geschrieben. Aber deren kritische Reflexion genügt Moritz nicht. Einleitend geht er davon aus, daß auch in kirchlichen Einrichtungen Österreichs während des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter beschäftigt waren, ohne zu erwähnen, daß diese vom Regime dorthin dirigiert und daß die meisten kirchlichen Einrichtungen von der NSDAP längst aufgelöst waren. Er erwähnt, daß der Widerstand, auf den die Kirche nach 1945 verwies, nur das Werk einzelner gewesen sei, daß die Bischöfe 1938 dem "Anschluß" an Deutschland vorbehaltlos zugestimmt und dem "Vernichtungskrieg" der deutschen Wehrmacht nicht widersprochen hätten.
Auch hält Moritz den Bischöfen vor, den Ständestaat der Jahre 1934 bis 1938 unterstützt und dadurch dem "Dritten Reich" vorgearbeitet zu haben. Doch hinter dem Ständestaat standen die der Kirche seit den Zeiten der Monarchie eng verbundenen Christlich-Sozialen. Daß die Bischöfe mit den beiden anderen politischen Lagern, dem sozialistischen und dem nationalen, wegen deren radikalem Antiklerikalismus nicht paktieren konnten, daß der Ständestaat Hitler den Weg nach Österreich abschneiden sollte und daß sein Führer Engelbert Dollfuß deswegen im Auftrage Hitlers ermordet wurde, wird nicht gewürdigt oder eher beiläufig erwähnt.
Der erste Teil des Buches gilt dem "Anschluß", dem Österreichs Bischöfe tatsächlich allzu schnell zugestimmt haben. Aber verdrängt wird, daß die Mehrheit der Österreicher den "Anschluß" wünschte und daß ihm 1938 der Sozialistenführer Karl Renner ebenso applaudiert hat wie der Wiener Kardinal Theodor Innitzer. Nach den das Selbstbestimmungsrecht mit Füßen tretenden Grenzziehungen von 1919 erblickten viele Deutsche und Österreicher jeglicher politischer Couleur im gemeinsamen Volkstum einen obersten politischen Wert; und erst recht taten das Menschen aus dem abgetrennten Böhmen und Mähren, sowohl Innitzer wie Renner gehörten zu ihnen. Daß das Großdeutschtum 1938 Bedenken gegen eine Vereinigung unter nationalsozialistischer Führung übertönen konnte, müßte ein Buch wie dieses erklären. Statt dessen verweist Moritz nur auf "Brückenbauer" zum Nationalsozialismus wie den Titularbischof Alois Hudal, den der Vatikan um 1933 hatte gewähren lassen, der aber 1938 keinen Einfluß mehr hatte.
Moritz verurteilt Innitzer, weil er sich 1938/39 von Hitlers Versprechungen wegen Kirchenfreiheit täuschen ließ, ohne hinzuzufügen, daß der Kardinal mehr Seelsorger und Sozialethiker als Politiker war. Er bereute seinen Irrtum bald und richtete 1940 eine "Hilfsstelle für Judenchristen" ein, um möglichst vielen von ihnen zur rettenden Ausreise zu verhelfen. Gewiß kann man für die folgenden Jahre auch den österreichischen Bischöfen vorsichtiges Taktieren vorhalten; aber immerhin waren sie an allen Einsprüchen des gesamtdeutschen Episkopats gegen die Eingriffe in das kirchliche Leben, gegen die Euthanasie und auch gegen den Rassismus beteiligt. Sie standen in einem ihnen aufgezwungenen Dauerkonflikt. Denn das "Dritte Reich" hat in der "Ostmark", weil es sie als konkordatsfreien Raum betrachtete, der Kirche noch ärger zugesetzt als im Altreich; alle katholischen Vereine und mehr als 200 Klöster wurden aufgelöst. Der besonders brutale Innsbrucker Gauleiter Franz Hofer kommt jedoch bei Moritz genausowenig vor wie sein prominentestes Opfer, der Prälat Carl Lampert, der mit anderen Geistlichen zunächst in das ferne Pommern verbannt und 1943 wegen angeblicher Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und hingerichtet worden ist. Er war nicht der einzige, den die Bischöfe nicht retten konnten.
Moritz' Gesamtbild wird durch Vorurteile getrübt. Er erwähnt nicht, daß die katholische Kirche um 1945 hohes Prestige besaß, weil sie dem nationalsozialistischen Regime widersprochen hatte. Ob laut genug, darüber mag man weiter diskutieren - und auch darüber, ob der ältere Antijudaismus die Rezeption des Rassismus erleichtert hat.
RUDOLF LILL
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
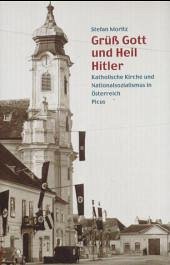





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.11.2003
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 05.11.2003