und der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts auftaucht? Peripher im Verhältnis zu Phänomenen wie der Industrialisierung, den modernen Naturwissenschaften, Revolution, Nationalismus und Krieg und deren Niederschlag in Literatur und Kunst?
Eine kunstgeschichtliche Dissertation aus der Humboldt-Universität Berlin geht unter dem Leitmotiv "Körper" der deutschen Griechenverehrung in der Zeit von 1840 bis 1945 nach. Sie wählt als Ausgangspunkt Rezeption und Aktualisierung des Winckelmannschen Klassikideals. In Frage steht ein Konzept, für dessen Entstehung zwar der Gründungsheros der deutschen Archäologie Johann Joachim Winckelmann konstitutiv war, das aber in der Folgezeit unterschiedliche Modifikationen und Funktionalisierungen erfuhr und auf stets neue Weise den kulturellen und politischen Diskurs und das Fühlen von Millionen Menschen in Deutschland vom Beginn des Kaiserreichs bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, ja bis in die sechziger Jahre maßgeblich prägte.
Esther Sünderhaufs Studie ist nicht die erste Auseinandersetzung mit deutscher Graecophilie und deren wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Folgen. 1996 hatte Suzanne Marchand in einem aufsehenerregenden Buch die institutionellen Aspekte des Phänomens herausgearbeitet und damit die deutsche archäologische Forschung, Museumspraxis und Schulpädagogik jener Zeit einer fundamentalen Kritik unterzogen. Sünderhauf geht es mehr um das Ideengeflecht, jenes intellektuelle Konzept und Gemisch aus Gefühlen und Sehnsüchten im Hinblick auf den Körper und ihm zugeschriebene Eigenschaften und Werte. Mit der Analyse von Körperkonzepten aber ist man stets beim Eingemachten; es ist diese Perspektive, die dem Buch Aktualität verleiht.
Bezeichnend ist die Wahl der untersuchten Zeitspanne. Thema ist nicht die Sturm-und-Drang-Phase deutscher Griechenbegeisterung, die als klassisch hellenische Skulptur samt ihrer - vor allem männlichen - Nacktheit zum Signet sexueller und politischer Freiheitsutopien avancierte. Sünderhaufs Analyse gilt schattigeren Gefilden deutschen Geistes- und Gefühlslebens. Ihre Darstellung setzt mit den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts ein, als die Auseinandersetzung mit Winckelmann in eine Memoria umgeschlagen war und dessen "libertines" und kosmopolitisches Pathos in Vergessenheit geriet beziehungsweise von anderen und sogar entgegengesetzten Vorstellungen überlagert wurde.
In jener "heroischen Erneuerungs- und Tat-Phase des deutschen Bürgertums", als Idealismus, Griechenkult und deutscher Nationalismus ihre enge und folgenreiche Verflechtung einzugehen beginnen, wird Winckelmanns Klassikideal zum ideologischen Kampfinstrument umgeformt. Es dient als Banner eines Konservativismus, der sich von modernen Erscheinungen wie dem Materialismus, der dominanten Rolle der Naturwissenschaften, dem Naturalismus in der bildenden Kunst und von demokratischen und sozialrevolutionären Bestrebungen bedroht sieht. Graecophilie wird zur staatstragenden Haltung. Winckelmanns Griechenideal mutiert dabei zum Signet einer deutsch-vaterländischen Nationalkultur.
Im Zuge jener Ummodellierung des Konzepts "Klassik" wird griechischer Plastik beziehungsweise der Sicht auf sie nicht nur jede kosmopolitische Note, sondern auch jede Sinnlichkeit systematisch ausgetrieben. Winckelmanns einst Natürlichkeit proklamierendes und eminent libidinöses Ideal verkehrt sich binnen einer Generation zum Garanten von Zucht und Selbstkontrolle, ja einer regelrechten Abstrahierung von Körperempfindung. Griechisch klassische Form soll nun den Blick auf die Natur ersetzen, mindestens ihn läutern; sie soll kraft ihrer Idealität die häßlichen Aspekte der Wirklichkeit eliminieren. Die unter diesem Gesichtspunkt von Sünderhauf erstmals herangezogenen archäologischen, kunstkritischen und pädagogischen Texte machen deutlich, wie sehr es in all jenen Debatten nicht nur um zeitgenössische Kunststile und die Einschätzung altgriechischer Kunst ging, sondern vor allem um das Leben selbst: um gelebte Körperkonzepte und deren ästhetische und ethische Bewertung.
Zwar sahen sich die Sachwalter edler Klassik in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts dem Verdikt akademischer Blässe und musealer Verstaubtheit ausgesetzt; man denke nur an so unterschiedliche Kritiker aus dem Lager des Vitalismus wie Friedrich Nietzsche und Richard Wagner. Doch während der Klassizismus in der bildenden Kunst ausgedient hatte, wurde der griechischen Antike im Zeichen eines wachsenden Kulturpessimismus nach 1890 eine neue Erziehungs- beziehungsweise Disziplinierungsfunktion zugesprochen. Griechische Skulptur und noch mehr die Orientierung an ihr stehen nun für die Werte Beherrschung, Zügelung, Bindung, Ungebrochenheit, Ganzheit, Einfachheit und Harmonie - im Kontrast zu unkontrollierter Entspanntheit, zu unübersichtlicher Vielfalt und zur Hyperkomplexität und schmerzhaft raschen Veränderung der erlebten Gegenwart.
Hatten am Ende des neunzehnten Jahrhunderts zwar die spezifischen Körperformen und Bewegungsmotive der griechischen Kunst, wie sie einst Winckelmann pries, ihre Vorbildfunktion für die Gegenwart eingebüßt, so wurde jetzt den Griechen ein Wille zu Form an sich attestiert, und das mit drohendem Unterton: ein unbedingter Wille, ein Wille nicht zu irgendeiner Form, sondern zu "eiserner Form". Der fiktive Grieche wird zum inneren Rekruten. Erziehungsziel ist nun durch Griechentum vermittelte äußere und innere Härte. Archäologen haben hier kräftig mitgewirkt, so Ludwig Curtius und Gerhard Rodenwaldt, Bernhard Schweitzer, Ernst Buschor und Ernst Langlotz. Gerade die von Sünderhauf eingenommene Binnenperspektive macht deutlich: Die Kreierung jenes von der Freiheit befreiten "klassischen Menschenbildes" kann nicht länger als bloße Anpassung an herrschende Machtverhältnisse verstanden werden, sie wurde von den Beteiligten mit Überzeugung fachlich untermauert und gesellschaftlich propagiert.
Das aggressive Modell einer Ausrichtung an antiker Körperlichkeit wurde im Nationalsozialismus auf die Spitze getrieben - dort gepaart mit ganz anderen Konzepten. Auch jene Phase erhellt das Buch durch überzeugende Analysen und durch Erschließung bislang unbeachteter Text- und Bildzeugnisse.
Doch nicht erst mit dem endgültigen Versagen des an einem fiktiven Griechentum orientierten Humanismus, sondern lange davor und auch in Milieus weit ab von Faschismus war jenem Syndrom "Griechenkörper" ein Gewaltpotential inhärent. Dessen schillernde Facetten aufgespürt und seinen Verwandlungen nachgegangen zu sein ist das Verdienst dieser Arbeit. Die Einbeziehung der lebenspraktischen Anwendungen des geschilderten Klassikkonzepts etwa in Freikörperkultur, Aktfotografie und Sport wird dem opulent bebilderten Buch eine weit über die Kunstgeschichte und die Archäologie hinausgehende Resonanz sichern.
LAMBERT SCHNEIDER.
Esther Sophia Sünderhauf: "Griechensehnsucht und Kulturkritik". Die deutsche Rezeption von Winckelmanns Antikenideal 1840-1945. Akademie Verlag, Berlin 2005. XII, 240 S., 7 Farb- u. 96 S/W-Abb., geb., 49,80 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
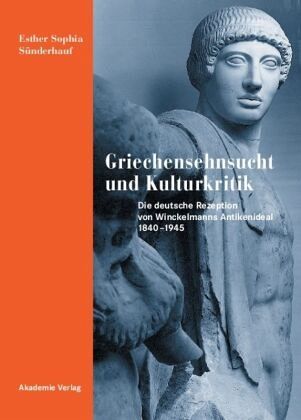




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.05.2005
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 20.05.2005