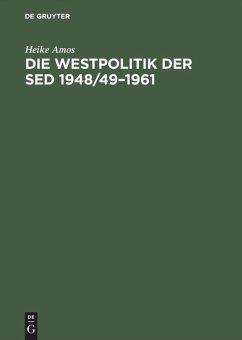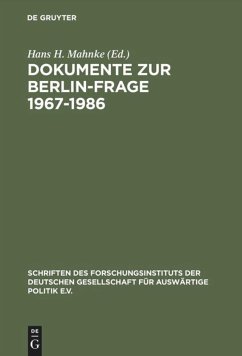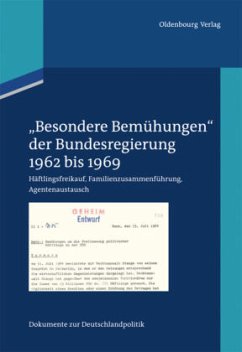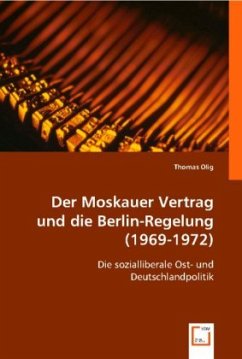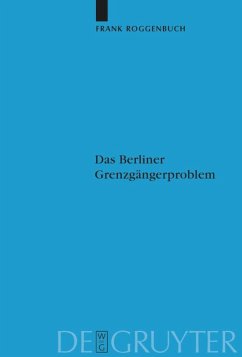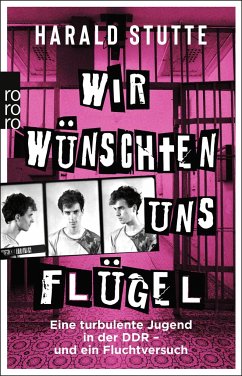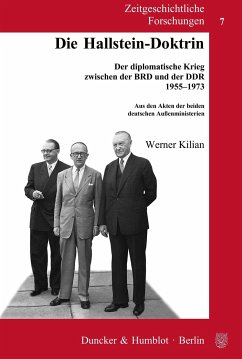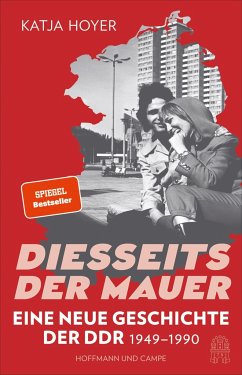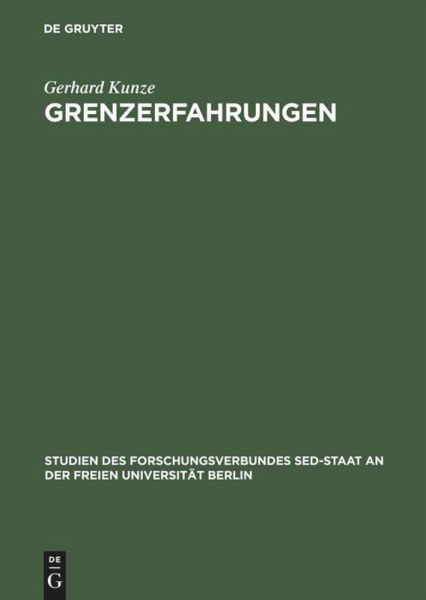
Grenzerfahrungen
Kontakte und Verhandlungen zwischen dem Land Berlin und der DDR 1949-1989
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
144,95 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
In seinem Buch hat G. Kunze sowohl seine persöhnliche Erfahrungen und Einsichten aus der Berliner Senatskanzlei, wo er für die Probleme in der Beziehung zu Ost-Berlin und der DDR verantwortlich war, als auch Aktenmaterial beider Seiten intensiv ausgewertet. Die Untersuchung spannt einen breiten Bogen von der Situation in Berlin nach der sowjetischen Blockade 1948 bis zum Fall der Mauer 1989.
Der Autor war seit den 50er Jahren an verantwortlicher Stelle in der Berliner Senatsverwaltung mit Problemen der Beziehungen zu Ost-Berlin bzw. der DDR befasst. Von 1973 bis 1989 war er als 'Besuchsbeauftragter des Senats' für die Durchführung der 1972 in Kraft getretenen 'Vereinbarung zwischen dem Senat und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik über Erleichterungen und Verbesserungen des Reise- und Besuchsverkehrs' zuständig. Als solcher führte er eine Vielzahl offizieller Gespräche mit Ost-Berliner Vertretern und kann wegen seiner 17jährigen ununterbrochenen Tätigkeit in dieser Funktion als wichtigster West-Berliner Verhandlungsführer und kenntnisreicher Experte auf diesem Gebiet bezeichnet werden. In seinem Buch hat G. Kunze sowohl seine persönlichen Erfahrungen und Einsichten verarbeitet als auch Aktenmaterial beider Seiten intensiv ausgewertet. Das ist insbesondere für die Überlieferung des Berliner Senats von großer Bedeutung, da diese wegen der 30jährigen Sperrfrist der zeitgeschichtlichen Forschung ansonsten nicht zur Verfügung steht. Die Untersuchung spannt einen breiten Bogen von der Situation in Berlin nach der sowjetischen Blockade 1948 bis zum Fall der Mauer 1989. Ein kurzer Einleitungsteil zeichnet die Versuche des West-Berliner Senats bis 1961 nach, fachlich-technische Kontakte mit Ost-Berliner Stellen zu etablieren, die die Spaltung der Stadt mindern sollten. Der zweite Teil beschäftigt sich mit den Bemühungen des Senats, die Folgen des Mauerbaus für die West-Berliner Bevölkerung zu mindern, indem zumindest Verwandtenbesuche in Ost-Berlin bzw. der DDR ermöglicht werden. Der Autor zeichnet die Passierscheinverhandlungen minutiös nach, charakterisiert die beiden Verhandlungsdelegationen, schätzt die jeweiligen Gesprächstrategien ein und bewertet die Ergebnisse. Im dritten Teil dokumentiert G. Kunze zunächst die Inner-Berliner Folgeverhandlungen des Vier-Mächte-Abkommens und beschreibt die Berlin-Politik der wichtigsten Protagonisten in den 70er und 80er Jahren. Schließlich geht er detailliert auf die thematisch erheblich ausgeweiteten Inner-Berliner Verhandlungen in dieser Phase ein.