Dichter seinem Vater "des Lebens ernstes Führen", der Mutter dagegen "Frohnatur" und die prägende "Lust zu fabulieren" bescheinigt. Das ist zwar typisiert, aber deshalb ist es nicht falsch. Johann Caspar Goethe, Jurist und kaiserlicher Rat, hatte auf alle Berufsausübung verzichtet und lebte dank eines ererbten Vermögens als Privatier; der unzufriedene Mann widmete sich mit ganzer Kraft der Bildung von Sohn und Tochter. Die volkstümliche Lebenslust der zwanzig Jahre jüngeren Mutter bot den didaktisch bedrängten Kindern Zuflucht.
Dagmar von Gersdorff korrigiert das hier immer naheliegende Vorurteil, Elisabeth Goethe sei ebenso ungebildet wie heiter gewesen. Aus ihren erhaltenen Briefen ergebe sich eine "beeindruckende Leseliste". Klassisches wie die "Odyssee" war ihr bestens vertraut, Vertracktes wie der "Tristram Shandy" gut geläufig, Klopstock, Lessing und Schiller hießen ihre Favoriten. Vor allem aber war sie eine begeisterte Goethe-Leserin. Was dieser über Christiane sagte ("Für meine Frau sind meine Werke tote Buchstaben; sie hat keine Zeile davon gelesen"), gilt hier nicht. Die Mutter hat jede verfügbare Zeile wahrgenommen und meist auch mit dem Lob quittiert, das der Dichter so dringend brauchte. Im Gegenzug hat er ihr dankbare literarische Denkmäler errichtet, allerdings nicht als Leserin. Vielmehr firmiert sie in "Hermann und Dorothea" als "würdige Hausfrau".
Das ist nicht gerade das Vokabular, mit dem man heute in den Gender Studies reüssiert. Während die Oberstimme dieser Biographie eine übersehene Bildungsgeschichte verfolgt, zeichnet die untere mit Verve das Porträt der "würdigen Hausfrau", wobei dieses Wort im damaligen Sinn zu verstehen ist: als Vorsteherin eines großen Haushalts mit viel Personal. Den Alltag der Elisabeth Goethe erschließt Gersdorff mit nüchternem Quellenmaterial. Neben den peniblen Verzeichnissen über sämtliche Ausgaben, die Johann Caspar Goethe bis kurz vor seinem Tod führte, sind dies vor allem die Haushaltsaufzeichnungen der Mutter selbst, ihre "Wirtschafts-, Spiel-, Wasch-, Zins- und Quittungsbücher", die bislang unausgewertet im Weimarer Archiv ruhten. Sie gewähren einen teilweise erfrischenden Blick auf den Lebensstil der Familie Goethe. Selbst der Umstand, daß man einen jungen Dichter im Haus hat, läßt sich den Ausgabenbüchern ablesen: "4 Buch concept Papier, 1/4 Schoppen Tinte". Wie fremd dem Autor das Lebensgefühl armer Poeten zeitlebens sein mußte, wird ebenfalls schlagartig deutlich. "Goethe besaß, als er nach Straßburg ging, 267 Servietten, 34 Tischtücher, 58 Laken, 108 Handtücher, 194 Hemden mit Manschetten und 82 Hemden ohne Manschetten." Allerdings sind nicht alle Details so aussagekräftig: "Siebe, Meßbecher, Mandelmühle, Gurkenhobel, Muskatreibe und Lichtschere waren aus Blech."
Daß Dagmar von Gersdorff die Haushaltsbücher als eminente Quellen präsentiert, liegt auch daran, daß über weite Lebensstrecken kaum andere Zeugnisse zu haben sind. Bei der großen Briefvernichtung von 1797 hat Goethe auch stapelweise Epistel seiner Mutter ins Feuer geworfen. Erst die Zeit nach dem Tod des Vaters ist besser dokumentiert. So bleibt der Autorin bis dahin wenig anderes übrig, als die aus "Dichtung und Wahrheit" und der Goethe-Biographik bekannte Geschichte der Familie noch einmal zu erzählen, wobei die verschobene Perspektive durchaus für eine reizvolle Lektüre sorgt. Nur passagenweise reduziert sich das Bemühen, die Mutter zum Erlebniszentrum zu machen, auf Zwischenrufe wie "bei alldem kann die Mutter nicht unbeteiligt gewesen sein".
Während der Vater sich über die wildgenialischen Sturm-und-Drang-Eskapaden des Sohnes so aufregt, daß er zur Ader gelassen werden muß, bietet die Mutter den jungen Rebellen ein gastfreies Haus. Ihre Toleranz muß außerordentlich gewesen sein. Sie verfügt selbst über Sturm-und-Drang-Rhetorik, wenn sie bekennt, daß ihre Seele "von Jugend auf keine Schnürbrust angekriegt" habe und "nicht wie die Bäume in den langweiligen Zier-Gärten verschnitten und verstümmelt worden" sei.
"Wer sollte die Mutter Goethes nicht persönlich kennen lernen wollen?" formulierte Wieland und machte sich als einer der ersten auf den Weg von Weimar nach Frankfurt, nicht ohne Scheu, denn vorab bat der damals angesehenste deutsche Schriftsteller die Gastgeberin, sich an seinen "Spindelbeinen nicht zu ärgern". Wieland fühlte sich in ihrem Haus "unsagbar wohl". Andere folgten, sogar die Weimarer Herzogin stattete ihren Besuch ab. Die Mutter wurde zu einer öffentlichen Person und genoß diese Rolle. Das Buch reiht viele Zeugnisse aneinander, und immer wieder erfährt man, was für eine temperamentvolle Erzählerin in geselliger Runde, was für ein prächtiger und allseits beliebter Mensch sie gewesen ist. Die Autorin ist fasziniert, aber der Leser vermißt neben dem Schuß Respektlosigkeit, der Biographien immer guttut, über längere Strecken auch das, was Lebensläufe spannend macht - innere Widersprüche und äußere Widerstände.
Nur einmal riskierte die fünfzigjährige Witwe den Spott der Umgebung. Die leidenschaftliche Theatergängerin verliebte sich in den jungen Schauspieler Unzelmann; es ergab sich ein enges Verhältnis, in dem es "vor erotischen Zwischentönen knisterte". Doch der Mime war verheiratet: "Zieht er eine vor, die hübscher ist, so wäre das zu begreifen, aber die Frau Rat!" kommentierte Frau Unzelmann. Wegen der merkwürdigen Affäre wurde die lange geplante Fahrt nach Weimar abgesagt. "Alle die Ursachen, die mich verhindern, anzuführen, wäre zu weitläufig", schrieb die Mutter ausweichend an den Sohn, der zur selben Zeit wegen Frau von Stein nicht nach Frankfurt kommen mochte und das in ähnlich vage Worte faßte: "Soviel innere wie äußere Ursachen halten mich ab."
Abhaltende Ursachen sind das Leitmotiv der letzten zwanzig Jahre. Elisabeth Goethe muß ihre gesamte Frohnatur aufbieten, um zu verkraften, daß der berühmte Sohn sie kaum noch besucht. Einmal meldet er sich an und kommt dann doch nicht. Enttäuscht schreibt sie ihm, daß sie sich tagelang am Fenster "bald blind gucke und jede Postschäße vor die deinige halte". Ein andermal kehrt er nur heim, um das Vaterhaus zu verkaufen - mit dem Erlös will er ein Landgut bei Weimar erwerben.
"Rigoroser Egoismus", lautet der nicht neue Befund. Weil die Mutter seine Schonungsbedürftigkeit respektierte, wollte sie ihm selbst dann nicht zur Last fallen, als Frankfurt von napoleonischen Truppen beschossen wurde und in Weimar Zimmer für sie schon hergerichtet waren. Dorthin ist sie nur im Schlaf gekommen: "Diese ganze Nacht träumte ich von Weimar". Aber Goethe träumte nicht von Frankfurt, wo die Mutter nun in einer kleinen Wohnung lebte; laut Gersdorff ein Grund mehr für den komfortgewöhnten Dichter, sich nicht mehr blicken zu lassen. "Es sind jetzt fünf Jahre, das ist kein Spaß", schrieb die Mutter. Es sollten noch einmal fünf vergehen; auch der Beerdigung blieb er fern, denn in diesen Jahren wollte er vom Tod nichts wissen. So steigert sich das wohlmeinende Buch auf den letzten Seiten noch in einen mittleren Goethe-Groll hinein. Die große Besuchsverweigerung ist der dramatische Höhepunkt. Daß das Mutterthema nicht ganz so viel Aufregendes bietet wie Goethes angefeindete wilde Ehe in Weimar, kann man der Autorin nicht anlasten. Sie hat das Beste daraus gemacht.
WOLFGANG SCHNEIDER
Dagmar von Gersdorff: "Goethes Mutter". Eine Biographie. Insel Verlag, Frankfurt am Main 2001. 463 S., geb., 49,80 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
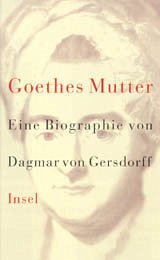




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.05.2001
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 15.05.2001