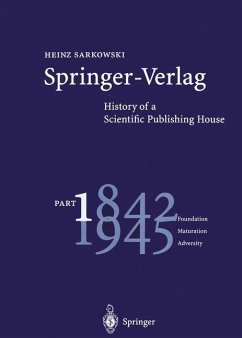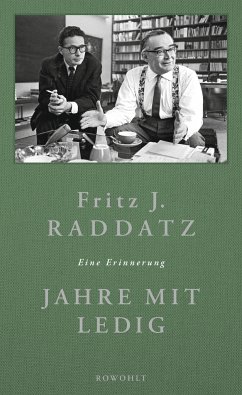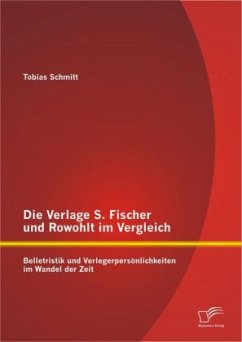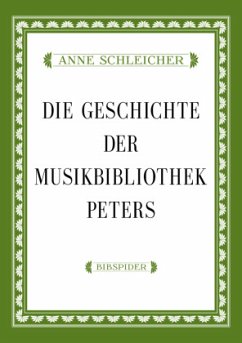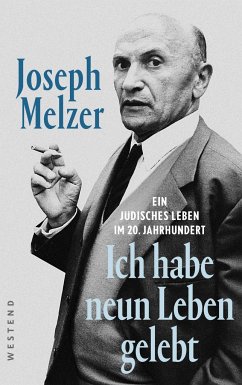Gegenwart kann man als beispielhafte Karriere der alten und neuen Bundesrepublik lesen. Wozu auch gehört, dass Naumann in der Wolle gefärbter Transatlantiker ist, mit tiefen Wurzeln in den Vereinigten Staaten, aber mit "angeborener Sprunghaftigkeit".
Seine Erwerbsbiographie im Schnelldurchgang: Journalist beim "Münchner Merkur", Wechsel zu "Zeit", wo er zu den Gründungsredakteuren des Magazins gehört. Habilitation an der Ruhr-Universität in Bochum, Stipendiat in Oxford, danach Rückkehr zur "Zeit", zunächst im Ressort Dossier, dann Korrespondent in Washington. Wechsel zum "Spiegel" als Leiter des Auslandsressorts. 1985 zum Rowohlt-Verleger in Reinbek berufen, nach zehn Jahren Umzug nach New York, um dort für Holtzbrinck den Literaturverlag Metropolitan Books zu gründen und den Verlag Henry Holt zu leiten. 1998 zieht es ihn als ersten Kulturstaatsminister in die Regierung Gerhard Schröder. Von dort aus erneuert er seine Liebe zur "Zeit", wo er zunächst zusammen mit Josef Joffe als Chefredakteur und Herausgeber fungiert.
Nebenbei moderiert er eine Talk-Runde für den RBB, gibt das "Kursbuch" und die Andere Bibliothek mit heraus. Im Hamburger Bürgerschaftswahlkampf 2008 ist er Spitzenkandidat der SPD - und unterliegt Ole van Beust. Danach Wechsel als Chefredakteur in Schweizer Diensten zum Monatsmagazin "Cicero" nach Berlin. Schließlich wird Naumann Direktor der Barenboim-Said-Akademie in Berlin, einer Musikhochschule für Stipendiaten aus dem ganzen Nahen Osten.
An Hunger erinnert sich Naumann kaum, wohl aber an eine glückliche Kindheit in den Ruinen der Nachkriegszeit. Über diese Lebensspanne schreibt er hinreißend, in eleganter Prosa schlägt er den Bogen zurück in die vierziger und fünfziger Jahre, spannt großformatige Familientableaus auf, bis man ihm beinahe folgt in dem Glauben, Köthen sei der Nabel der Welt. Heimat, das hat für ihn etwas mit Familiengrabstätten und mit Sprache zu tun: "Dialekte können wie akustische Ausweispapiere wirken, die manche Menschen auch wider Willen ein Leben lang bei sich tragen." Naumann zielt damit auf den Franken Henry Kissinger, dem er sich nie getraut hat seine Abneigung zu gestehen. An Gott hat er früh nicht glauben können und es später auch nicht mehr versucht. Seine Neigung, "nein" zu sagen, hat dagegen lebenslang Bestand. Seine "existenzielle Faulheit" macht ihn "untauglich für ernsthafte Philosophie".
1953 flieht die Mutter mit ihren Kindern nach Westberlin, landet in einem Durchgangslager für Flüchtlinge aus der DDR in Wentorf bei Hamburg, schließlich in Köln. Die Verhältnisse sind bescheiden. Diese Anfänge zeigen naturgemäß einen neuen Michael Naumann, einen, dessen Persönlichkeit noch nicht überlagert ist vom medialen Bild, das er sich später zulegt. Er ist zu klug, um so zu tun, als ginge es dabei zu jeder Zeit um Aufrichtigkeit - das wollen Memoiren nie sein, auch wenn sie es von sich selbst behaupten. Manches wird verschwiegen, und wer hier nicht vorkommt, wird wissen, warum. Seinen Nachfolger im Amt des Kulturstaatsministers, den Parteifreund Julian Nida-Rümelin, erwähnt er nicht, dafür berichtet er vom auskömmlichen Verhältnis zu dessen Nachnachfolger Bernd Neumann.
Gewiss verblasst manche Erinnerung nach so vielen Jahren. Aber dass Naumann, der bei Eric Voegelin in München mit der Arbeit "Der Abbau der verkehrten Welt. Satire und politische Wirklichkeit im Werk von Karl Kraus" promoviert wurde, ausgerechnet Kraus' berühmtesten Satz ("Mir fällt zu Hitler nichts ein.") verdreht, muss man wohl diskret auf das Konto des Lektorats buchen, das auch das Kartenspiel Schafkopf mit einem Schafskopf verwechselt.
Bei den Frauen hat Naumann einen Schlag. Die erste Ehe mit Christa Wessel, der Tochter des BND-Präsidenten Gerhard Wessel, geht allerdings in die Brüche; in zweiter Ehe ist er mit der Medizinerin Marie Warburg verheiratet, die aus der bekannten Bankiersfamlie stammt. Private Epochenbrüche sowie körperliche Malaisen werden nur kurz gestreift, der öffentliche Naumann hat stets Vorrang. Und der ist bestens vernetzt. So gut, dass er sich mit längeren Reminiszenzen an prägende Weggefährten zurückhalten muss, um den Rahmen nicht zu sprengen. Die Gräfin Dönhoff erhält ein wenig mehr Raum, ebenso Helmut Schmidt, Rudolf Augstein, Gerhard Schröder, Daniel Barenboim. Viele Autoren streift er nur: Elfriede Jelinek, Thomas Pynchon, Herta Müller, Rosamunde Pilcher, Stephen Hawking. Spitze Bemerkungen gehören unbedingt zu dieser Sorte gehobenen Klatsches, seinen ehemaligen Arbeitgeber in Hamburg nennt der Autor heute ein "Konsensblatt". Eitelkeiten? Durchaus. Als der Staatsminister Naumann seine Mutter informiert, er sei im Fernsehen zu sehen, bemerkt diese angesichts der Fernsehbilder trocken: "Geh zum Friseur, Junge."
Professionelle Parteipolitiker erteilen ihm manche Lektion, die er erst verdauen muss. Mit seiner Ablehnung des Holocaust-Mahnmals macht er sich Feinde. Dass das immer gieriger werdende Geschäftsgebaren der Investmentbanken von der Regierung Schröder nicht hinreichend begriffen wurde, liefert einen aufschlussreichen Einblick in den Politikbetrieb jener Jahre. Inklusive solcher Pointen: "Credit Fault Swaps tauchen im Wörterbuch des Marxismus-Leninismus nicht auf."
Die schönste Zeit aber sind ihm die Verleger-Jahre gewesen. Obwohl er sie sich unter Schmerzen erkämpfen musste, denn die Rowohlt-Mitarbeiter lehnten seine Bestellung zunächst vehement ab. Zehn Jahre, fünf Nobelpreise und eine Umsatzverdoppelung später sah das für den vormals "teuersten Lehrling des deutschen Verlagsbuchhandels" anders aus. Schon damals lernte er: "Verleger sind eben stes die Bankiers von Autoren, nur selten wahre Freunde." Apropos: Beinahe neunhundert Namen verzeichnet das Personenregister.
Rechthaberisch wirken Naumanns Erinnerungen nie, selten gestattet er sich Abstecher in die kulturelle Verarmungskrise des Internetzeitalters. Und ganz am Ende, bei den Bauarbeiten für die Barenboim-Said-Akademie, entdeckt Michael Naumann seine Bewunderung für die Arbeiterklasse. Auf der Baustelle. "Handfestes, Handwerkliches und physisch harte Arbeit" seien ihm bis dahin fremd gewesen. Ein Eingeständnis, das Ehre einlegt für die These, Intellekt sei ständige Korrekturbereitschaft. Michael Naumann präsentiert sich als der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Im Zweifelsfall konnte er sich darauf verlassen, dass jemand anrief und ihm eine neue berufliche Perspektive bot. Der Titel dieser süffig zu lesenden Erinnerungen ist gut gewählt.
HANNES HINTERMEIER
Michael Naumann:
"Glück gehabt". Ein Leben.
Hoffmann und Campe
Verlag, Hamburg 2017.
415 S., geb., 24.- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
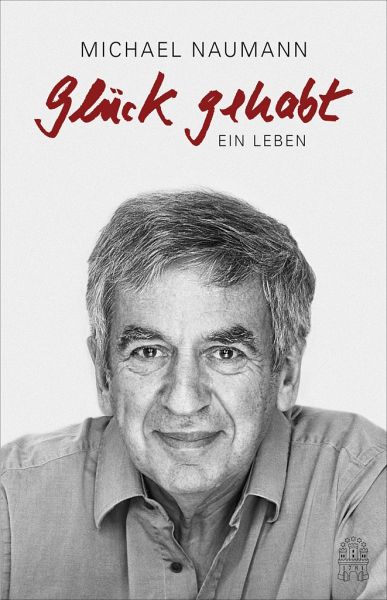





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.04.2017
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 22.04.2017